horus 2/2025
Schwerpunkt: "Tierisch, tierisch"
Inhalt
- Vorangestellt
- Aus der Redaktion
-
Schwerpunkt: "Tierisch, tierisch"
- L. Mümmler: Vom Blinddate zum Festivalführhund
- "Mit meinem Führhund hatte ich wieder ein völlig neues Mobilitätsgefühl". Über den Weg zum eigenen Führhund - Johannes Sperling im horus-Interview mit Thorsten Büchner
- Mit sechs Beinen geht es besser oder: Warum blinde Menschen auf den Hund kommen. Mirien Carvalho Rodrigues im horus-Interview mit Peter Beck
- Tauben in der Stadt - von Tierschutz ist selten eine Rede. Marion Happe im horus-Interview mit Sabine Hahn
- M. Herrmann: Ein Leben ohne Pferd ist möglich, aber sinnlos! Frei nach Loriot
- J. Hüttich und D. Balzer: Sportunterricht mit Kopf, Herz und Huf an der blista
- G. Lütgens: Tiere in meiner Nähe oder: Auch für Ohr und Hand sind Tiere interessant
- M. Saegbebarth: Unterwegs im Großstadtdschungel - Den Zoo Leipzig mit allen Sinnen erleben
- Dr. E. Hahn: Nur nicht knausern!
- Beruf, Bildung und Wissenschaft
- Recht
- Noch 200 Jahre Brailleschrift?
- Aus der Arbeit des DVBS
- Aus der blista
- Bücher
- Panorama
- Impressum
- Anzeigen
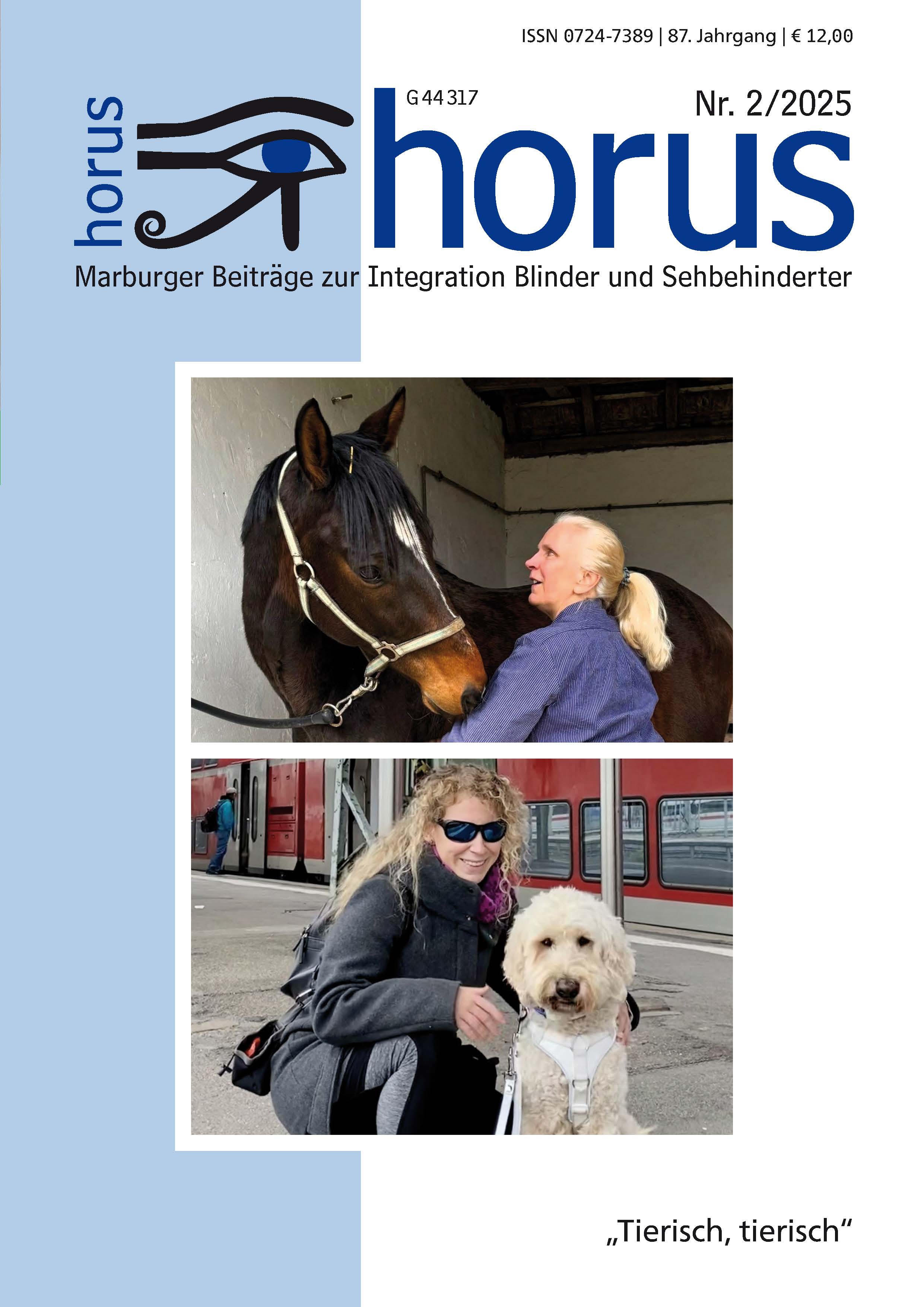
Titelbild horus 2/2025
Vorangestellt
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Tierisch, tierisch“ ist der Titel des horus-Schwerpunkts dieses Mal. Wie das, mögen sich die Leserinnen und Leser dieser Zeitschrift fragen, wo ist denn die Verbindung zu Blindheit und Sehbehinderung? Der Schlüssel dafür ist hier: Unsere Zeitschrift berichtet nicht nur von außergewöhnlichen Entwicklungen oder Leistungen blinder und sehbehinderter Menschen. Es soll auch deren Alltag in den Blick kommen, der Alltag in Beruf, Hobby und Freizeit. Und so ist das Thema der Nummer 2/25 das Leben mit Tieren und das Engagement für die animalische Kreatur. Erwartbar kommen Führhunde vor, aber auch Pferde und sogar Tauben – deren Ruf ist schlecht, sie sind aber durchaus liebenswert.
Auch manche Zoos haben inzwischen begriffen, dass Tiere nicht nur betrachtet werden können, dafür gibt es gleich zwei Beispiele in dieser Ausgabe. Meine Tochter schenkte mir einst zu meinem 50. Geburtstag einen Besuch bei Schlangen im Terrarium der Stuttgarter Wilhelma. Vipern, Nattern, Pythons & Co. – ich finde diese Tiere, die bei vielen Menschen Ekel und Schrecken hervorrufen, faszinierend und durchaus sympathisch. Es war ein grandioser Nachmittag. Unvergesslich ist mir die Entschlossenheit einer Riesenschlange, die sich in den Kopf gesetzt hat, ihren Weg von A nach B zu nehmen. Und will sie eine kräftige Hand aufhalten oder in eine andere Richtung lenken, so ignoriert sie das, dank ihrer enormen Muskelkraft wird sie dennoch ihren eingeschlagenen Weg nehmen. Schlangen können nicht hören, sie haben keine äußeren Ohren, und einige Schlangenarten sind fast blind. Aber sie nehmen kleinste Erschütterungen des Bodens wahr und sind hellwach, wenn es um ihre Interessen geht. So muss also nicht unbedingt ein Adler oder Tiger herhalten, wenn es um Kraft geht – auch wer äußerlich nicht viel hermacht, wie eine Schlange, hat es in sich! Das finde ich ermutigend, gerade für unsere Selbsthilfe, die allzuoft unterschätzt wird.
Auch wenn ich ein bekennender Nichtführhundhalter bin und keinen Gaul im Stall brauche, freue ich mich über die Begegnung mit Tieren. Sie sind für mich wie Enkel: Schön, wenn sie kommen, und gut, dass sie wieder gehen.
Erfreuliche Begegnungen mit diesem horus
wünscht Ihnen und Euch
Peter Beck
(horus-Redakteur)
Bild: Peter Beck hat braune Augen und dunkles, meliertes Haar. Sein Pony fällt asymmetrisch über die hohe Stirn des zentriert ausgerichteten Gesichts. Foto: privat
Aus der Redaktion
Konferenz ohne Tiere
Seit langem schon waren die Redaktionstreffen nicht mehr so heiter wie zu unserem Schwerpunkt-Thema „Tierisch, tierisch“. Keine Fliege schwirrte im Winter durchs Büro, keine Maus lief über den Boden, als das Brainstorming vollkommen frei von Tierhaarallergenen online stattfand. Viele Geschichten aus der Kindheit und Jugend tauchten auf, Zeiten, in denen wahrscheinlich die größten Zu- oder Abneigungen gegenüber einer bestimmten Tierart entstanden: Eine zahme Ratte als Haustier, ein Abkömmling aus einem Tierversuchslabor, wie niedlich! – Undenkbar auf dem Bauernhof mit Nagetier-Plage! Die vielen skurrilen Todesarten bzw. kurzen Leben der eigenen Haus-, wenn auch nicht immer Kuscheltiere! Und wer würde sich wie Thorsten und Isabella trauen, einen „nassen Kuss“ von zwei Seelöwen zu bekommen? Wie immer scheint es bei Begegnungen, auch mit dem Tier, auf den richtigen Abstand und den Kontext anzukommen. Dass jedoch mit den Anekdoten auch die Ideen kamen, welche Expertin und Experte welches Thema vertiefen könnten, damit horus den gewohnten Info-Mehrwert erhält, das werden Sie auf den folgenden Seiten schnell selbst merken.
„Alles, was Recht ist“
Streitlustiger wird es in der nächsten horus-Ausgabe zugehen, die sich mit rechtlichen Angelegenheiten befassen wird. Da viele der längsten deutschen Wörter aus dem Bereich Recht und Verwaltung stammen, können Sie schon mal Wetten abschließen, bis zu welcher Wortlänge es eines in den horus schafft. Es soll darum gehen, wie blinde und sehbehinderte Menschen zu ihrem Recht kommen, wie sie in juristischen und Verwaltungsberufen arbeiten, an welchen Themen die Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe aktuell arbeitet und wo Sie als Leserin und Leser der Schuh drückt, der mit etwas mehr Recht und Gerechtigkeit leichter würde. Schreiben Sie uns gerne von Ihren Erfahrungen! Ihr Beitrag kann bis zu 12.000 Zeichen lang sein und sollte bis zum Redaktionsschluss am 20. Juni an horus@dvbs-online.de eingehen. Die Redaktion freut sich darauf!
Bild: Zwei große braune Seelöwen stupsen mit ihrer Schnauze Isabella Brawata, die in ihrer Mitte steht, jeweils rechts und links über ihrem Ohr an. Sie hält ihre Hände an deren nasse Hälse und lacht. Foto: privat
Schwerpunkt: "Tierisch, tierisch"
L. Mümmler: Vom Blinddate zum Festivalführhund
Von Lisa Mümmler
Ich schloss die Augen, ließ mich tief ins Kissen sinken, lauschte der Stille und fühlte mit all meinem Sein, dass an diesem Dezemberabend mein altes Leben enden und mit dem morgigen Augenaufschlag ein neues beginnen würde. Mein Leben mit Führhund. Mein Leben mit Harry.
Die Idee zum Blindenführhund wurde im Sommer 2016 geboren. Nach langem Kampf um das Rezept landete vier Jahre später die Bewilligung in meinem Briefkasten – ein papierener Schatz, auf dem noch heute die Spuren meiner Freudentränen zu sehen sind. Mindestens zwölf Monate Wartezeit wurde mir angekündigt. Doch Mitte November las ich „Dringender Rückruf erbeten“ auf meinem Smartphonedisplay. In zwei Wochen sollte ich meinen Führhund bekommen. Schlagartig war ich in Aufruhr. So viel vorzubereiten! Am selben Tag bestellte ich ein Hundebett, Näpfe und einen Sack Futter. Ich informierte meinen Arbeitgeber, meinen Vermieter, ließ mich „zur Anpassung von Hilfsmitteln“ krankschreiben, buchte die Fahrkarte… die Checkliste war plötzlich abgehakt, mir blieb nur noch das Warten. Zähes, vorfreudiges, schier unerträgliches Warten.
Und dann war sie da, unsere erste Begegnung. Unser Blinddate. Nach einer unruhigen Nacht mit drei Stunden Schlaf klingelte die Trainerin der Führhundschule pünktlich um 10 Uhr. Sie stand mit einem blonden, flauschigen Etwas vor der Türe. Oh Gott, das war er also. Der Hund. Viel größer als auf dem Foto, das ich gesehen hatte. Ich unterhielt mich mit der Trainerin, aber ich hatte nur Augen für das wuselige Bärchen, das schwanzwedelnd um mich herum hüpfte und aufgeregt durch die Wohnung flitzte – die Nase am Boden, flankiert von wehenden Schlappohren.
Ignorieren sollte ich ihn erstmal, damit er sich beruhigt. Und wer beruhigte mich? Vor Hunden hatte ich mein Leben lang Angst. Sobald ich merkte, dass mir einer entgegenkam, habe ich die Straßenseite gewechselt. Meinen ersten Nebenjob als Prospekteverteilerin kündigte ich schließlich wegen der Hunde, die hinter Briefkastenschlitzen und Gartentoren tobten. Aber ich wusste auch, dass meine Angst aus dem Unbekannten resultierte. Ich verstand Hunde nicht, kannte weder ihre Verhaltensweisen noch ihre Körpersprache. Trotzdem ließ ich mich auf das Abenteuer Führhund ein, denn ich wusste, dass ich meinen eigenen Hund von Grund auf kennenlernen würde. Und mit den blonden Löckchen, den tapsigen Pfoten und den braunen Knopfaugen sah Harry wirklich nicht zum Fürchten aus.
Gelassener wurde ich, als wir zur ersten Gassirunde gingen. Frische Luft, durchatmen. Ich bekam viele Infos, Kommandos mit Laut- und Handzeichen sowie eine Flexi-Leine, mit der ich den zwanzig Monate alten Goldendoodle über die hauseigene Wiese führte. Er war so süß! Dieser leichtfüßige Gang, das neugierige Näschen übers Gras tanzend und die Rute wie ein fröhliches Fähnchen erhoben. Kurz darauf lernte ich außerdem seine Pinkel- und Häufchenhaltung kennen. Für ein Blinddate ganz schön persönlich.
Dann waren wir allein. Er und ich. Beide aufgeregt und unruhig. Harry verfolgte mich auf Schritt und Tritt. Ich ging zur Kaffeemaschine. Tapp tapp tapp. Ich ging ins Bad. Tapp tapp tapp. Ich hatte jetzt einen Hund, nur überhaupt keine Ahnung, wie ich mit ihm umgehen, was ich mit ihm tun sollte. Mit Tieren generell habe ich keine Erfahrungen, da ich gegen viele allergisch bin. Durch puren Zufall fand ich 2016 heraus, dass ich nur auf manche Hunderassen reagiere. Darum auch ein nichthaarender Goldendoodle. Und der saß nun neben mir mit seinem schäfchenweichen Fell, gerade nah genug, dass ich ihn streicheln konnte, und wir „nahmen Kontakt auf“. Mehr als Kopf und Rücken ging da noch nicht – absurd, wenn ich heute darüber nachdenke, wo ich ihm den Schlaf aus den Augen reibe, Zähne und Lefzen kontrolliere, seine Pfoten und Ohren putze und vieles mehr.
Großen Respekt hatte ich vor dem ersten Gang am Führbügel. Im Vorfeld hatte ich gehört, dass Führhundhaltende mit Sehrest oft Schwierigkeiten hätten, sich auf den Hund einzulassen. Das verunsicherte mich mit meinen acht Prozent Restsehvermögen und den fünf Grad Gesichtsfeld. Zu Unrecht. Als es soweit war, hielt ich mich am Führgeschirr, gab Harry das Go und etwas in mir machte Klick, fühlte sich einfach richtig an. Beschwingt ließ ich mich von Harry durch die fremde Stadt leiten – voller Bereitschaft, diesem Hund irgendwann zu vertrauen.
„Irgendwann“ kam schneller als gedacht. Wir bestanden unsere Gespannprüfung, gewöhnten uns mit Höhen und Tiefen aneinander und sind seit vier Jahren ein unzertrennliches Team. Gewünscht hatte ich mir einen Führhund, der mich auf meinen Wegen entlastet. Bekommen habe ich so viel mehr. Die Führarbeit ist nur ein kleiner Part von dem, was Harry mir schenkt. Er ist Teil meiner Familie, bringt mich mit seiner charmanten, drolligen Art zum Lachen, spendet Trost, wenn ich traurig oder krank bin, und gibt mir Sicherheit und Zuversicht. Und ich darf mich um seine Bedürfnisse kümmern, ihn pflegen, ermutigen, Spiel-Dates für ihn arrangieren und sein Fels in der Brandung sein. Er hat sich nicht bei mir als Assistenzhund beworben, er hat sich das nicht ausgesucht. Schon alleine darum möchte ich ihm das schönstmögliche Leben bieten, als ein tägliches Dankeschön für alles, was er für mich tut.
Wie sehr Harry mein Leben verändert hat, erkenne ich überdeutlich im Rückblick. Zum Beispiel habe ich seinetwegen nun ein Gartengrundstück. Ursprünglich wollte ich eine kleine, eingezäunte Wiese pachten, letzten Endes kaufte ich einen 800 Quadratmeter großen Schrebergarten. Die Vorbesitzer hatte Harry bei der Besichtigung ordentlich um die Pfote gewickelt. In unserer grünen Oase treffen wir uns seither mit Familie und den vielen neuen zwei- und vierbeinigen Freund*innen, die wir auf Gassirunden und über Online-Anzeigen für Hundebegegnungen gefunden haben. Limo und Hundepool gibt’s im Sommer, Glühwein und Schneebälle im Winter.
Tollen Austausch fand ich in einer WhatsApp-Gruppe für Führhundhaltende im Raum Stuttgart. Über Umwege kam ich dadurch zu einem neuen Ehrenamt: Ich wurde stellvertretende Leiterin der Führhundfachgruppe des Blinden- und Sehbehindertenverbands Württemberg. In dieser Funktion organisiere ich mehrmals im Jahr Stammtische für Führhundhaltende oder unterstütze Mitglieder dabei, selbst Treffen durchzuführen. Anliegen aller Art beantworte ich per Mail, telefonisch oder über WhatsApp – die Kontakte sind vielfältig. Manche Leute möchten einen Führhund beantragen und haben viele Fragen dazu. Andere haben bereits einen vierbeinigen Helfer und brauchen Unterstützung bei verweigertem Zutrittsrecht. Es kommen aber auch Anfragen von Studierenden, die für eine Arbeit recherchieren. Neben zahlreichen Umfragen, Fragebögen und Interviews wurden Harry und ich einige Wochen von einem Filmstudenten mit der Kamera begleitet. Entstanden ist ein 25-minütiger Dokumentarfilm über uns. Das war eines dieser vielen Erlebnisse, das ich ohne Harry nicht gehabt hätte.
Genauso wie das Fotoshooting für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für die Bundesinitiative Barrierefreiheit. Unerwartet kam diese wundervolle Erfahrung zu mir. Die Mitarbeiterin der zuständigen Agentur rief mich an, meinte, jemand hätte mich für das Shooting vorgeschlagen und ihr ein Bild von Harry und mir geschickt. Ich hatte mich dort also nicht beworben, aber sie wollten mich haben! Perplex und neugierig sagte ich zu. Das bedeutete eine Reise von Stuttgart nach Berlin. Geplant war eine gemütliche Zugfahrt, aber bundesweite Warnstreiks machten uns einen Strich durch die Rechnung. Schließlich fuhren meine Eltern uns mit dem Auto in die Hauptstadt und Harry und ich kamen pünktlich zum Shooting.
Eine völlig neue Welt für uns. Die Location, nachts ein Tanzclub, war voller beschäftigter Menschen. Leute von der Agentur, der Fotograf und Personen vom BMAS. Und mein Goldbärchen und ich mittendrin. Ich probierte ein paar Outfits an, bekam etwas Puder ins Gesicht, und Harry, frisch gewaschen und gebürstet, war natürlich perfekt, so wie er war, und bezauberte die Crew. Einen ganzen Vormittag dauerte das Shooting und unser Foto hing für mehrere Wochen an Bahnhöfen, Litfaßsäulen und Haltestellen, wurde in Online-Anzeigen ausgespielt und in Fachmagazinen abgedruckt.
Ja, mit Harry geht es wohl nicht ohne Rampenlicht. So wurde er zufällig Maskottchen für das Louis Braille Festival 2024 in Stuttgart. Das kam so: Seit drei Jahren arbeite ich beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) als Redakteurin für das Verbandsmagazin Sichtweisen. In der Berliner Geschäftsstelle freute man sich über die Stuttgarter Kollegin vor Ort. Insbesondere die Führhundlounge sollte ich mitorganisieren. Bei der Besichtigung des Geländes wurde ein Bild von Harry geschossen, das auf Social Media gut ankam. Daraus entstand die Idee des Festivalführhundes: Mit schönen Fotos und Videos vor Stuttgarter Kulissen warb Harry für das Festival. Wir zeigten den Schlossplatz, den Bahnhof, besuchten den SWR und das Mercedes-Benz-Museum. Schließlich trafen sich Festival-Schirmherr und Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, und Festivalführhund Harry vor dem Neuen Schloss zum Pressetermin. Kein Wunder, dass Harry für dieses Event sogar seine eigenen Autogrammkarten, natürlich mit Pfotenabdruck, bekam.
Ich hätte mir bei meinem Antrag nie träumen lassen, was ich alles mit und wegen Harry erleben würde, wohin die Reise führen würde. Beruflich und privat. Und leider nicht immer nur auf die Sonnenseite. Drei Monate, nachdem wir zusammengefunden hatten, musste ich meinen Liebling in die Tierklinik bringen – vergiftet. Als Golden-Retriever-Pudel-Mischling ist Harrys größter Fehler, wenn man das so nennen möchte, dass er Abfälle und so manches Taschentuch vom Boden frisst. Durch meine anfänglichen Ängste habe ich mich nicht getraut, ihm aufgenommene Dinge aus dem Maul zu nehmen. Etwas, das sich mit einem Schlag geändert hat nach dem überstandenen Klinikbesuch. Ich schwor mir, lieber einen Biss zu riskieren, als jemals wieder dieses furchtbare, hilflose Bangen durchmachen zu müssen. In städtischen Grünanlagen trägt Harry einen Fressschutz.
Hart war auch die Diagnose, die Harry im vergangenen Jahr bekommen hat: Aufgrund von Rückenbeschwerden wurde ein Röntgenbild angefertigt, das eine beginnende Spondylose, eine Erkrankung der Wirbelsäule, zeigte. Ich googelte, sah mein Bärchen an und mir brach es das Herz. Unheilbar. Degenerativ. Diese beiden Worte waren wie ein Schlag ins Gesicht. Ich weinte, einen Tag und eine Nacht. Dann legte sich der Schock und ich wurde wieder handlungsfähig. Sofort stellte ich unseren Alltag um: Orthopädische Hundebetten wurden besorgt, Nahrungsergänzungsmittel für Rücken und Gelenke bestellt und rückenunfreundliche Gewohnheiten gestrichen. Stattdessen gehen wir zur Physiotherapie, wo ich lernte, Harry effektiv zu massieren und mit einfachen Mitteln im Alltag zu trainieren. Denn Muskelaufbau ist das A und O. Darum haben wir mittlerweile ein Set Steckhürden zu Hause, ein Balance Board für Gleichgewichts-Übungen und Hütchen für Slalom. Dreimal wöchentlich baue ich aus unserem bunten Trainingszubehör einen Parcours quer durch die Wohnung, und Harry absolviert ihn, wie es sich für einen sportlichen, schlauen Doodle gehört, mit Bravour.
Durch all diese Maßnahmen ist er nicht nur schmerzfrei, unsere Bindung ist durch die präventiven Maßnahmen noch inniger geworden. Das gemeinsame Training macht uns Spaß, und ich liebe es, wie Harry neue Übungen meistert, wie er mehr und mehr versteht, was ich von ihm will, wenn ich ihm Neues zeige. Wie wir uns auch durch schlechte Zeiten kämpfen und die guten dadurch umso intensiver erleben.
Ich bin so unendlich dankbar und überglücklich, diesen wunderbaren, liebenswerten Begleiter an meiner Seite zu haben. Gemeinsam stellen wir uns der Zukunft: Vier Pfoten und zwei Beine, verbunden durch einen Führbügel und Vertrauen.
Zur Autorin
Lisa Mümmler (36) hat Germanistik und Philosophie in Heidelberg studiert und arbeitet seither als Online-Redakteurin, zunächst im Marketing, seit 2022 in der Selbsthilfe beim DBSV. Seit Kurzem moderiert sie den Podcast „Fell und Führbügel“ (https://fell-und-fuerhbuegel.podigee.io/). Ihre Freizeit verbringt sie mit Yoga, Pilates, Wandern, Ausflügen und Reisen, kreativen Dingen – und natürlich mit ihrem Führhund Harry.
Bild: Führhund Harry bleibt auch auf dem Bahnhof gelassen. Der cremeweiße Goldendoodle mit lockig-flauschigem Fell sitzt auf dem Bahnsteig, Lisa Mümmler geht neben ihm in die Hocke und legt eine Hand auf seine Schulter. Lisa Mümmler hat langes, lockiges Haar und trägt eine große, sportliche Brille mit schwarz getönten Gläsern. Foto: privat
Bild: Lisa Mümmler lächelt. Sie hat ein schmales Gesicht, blaue Augen und blondes, schulterlanges, lockiges Haar. Foto: privat
"Mit meinem Führhund hatte ich wieder ein völlig neues Mobilitätsgefühl". Über den Weg zum eigenen Führhund - Johannes Sperling im horus-Interview mit Thorsten Büchner
horus: Bevor wir uns inhaltlich dem Thema Blindenführhund nähern. Wie ist deine persönliche Beziehung dazu und wann hattest du zum ersten Mal Berührungspunkte mit Führhunden?
Johannes Sperling: Ich bin eigentlich mit Hunden aufgewachsen und wusste früh, dass ich später auch Hunde haben wollte. Während meiner Schulzeit in Marburg und auch in meinen ersten Studienjahren dort habe ich noch ein wenig gesehen. Ein paar Bekannte von mir hatten Führhunde, und ich war fasziniert, was die konnten. 2009 verschlechterte sich meine Sehkraft dann rapide und ich bin erblindet. Dann haben meine Geschwister mich auf die Idee gebracht, mich um einen Blindenführhund zu bemühen. Ein Jahr später habe ich dann Goya bekommen und hatte ein völlig neues Mobilitätsgefühl. Derzeit habe ich keinen eigenen Führhund, kümmere mich aber ein wenig mit um den schon älteren Führhund meiner Freundin.
h.: Was würdest du sagen? Für wen können Führhunde eine Alternative zum Langstock sein?
J. S.: Zunächst einmal: Für Leute, die sich ein Leben mit Hund vorstellen können. Das klingt vielleicht seltsam, aber es ist elementar wichtig. Du musst dich auf ein Tier einlassen wollen, das Aufmerksamkeit, Pflege und Beschäftigung braucht. Der Hund muss zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter raus, ist auch mal krank, wird alt und sterben. All das muss in dein eigenes Leben passen und sollte am Beginn deiner Überlegungen stehen. Nicht nur die Vorteile, die ein Führhund mit sich bringen kann. Wer prinzipiell gut mit dem Stock zurechtkommt, sich aber eine einfachere und schnellere Fortbewegung wünscht, könnte von einem Führhund profitieren. Viele Führhundhaltende sind auch späterblindet und fühlen sich mit Hund eher an ihre früheren Gehgewohnheiten zurückerinnert. Ein Führhund, der beispielsweise Hindernisse umgehen, Treppen anzeigen oder in gerader Linie über große Plätze laufen kann, erleichtert die eigene Orientierung und Mobilität enorm.
Klar muss aber auch sein: Der Hund kann solch anspruchsvolle Arbeit nur wenige Stunden am Tag leisten und braucht dabei auch Pausen. Kurzum: Für alle, die sich vorstellen können, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, das ihnen gelegentlich bei Orientierung und Mobilität hilft.
h.: Kann mich jemand im Entscheidungsprozess unterstützen?
J. S.: Was ich auf jeden Fall raten würde, ist, mit Führhundhaltenden Kontakt aufzunehmen. Das geht oft sehr gut über die Landesvereine im DBSV. In vielen gibt es Ansprechpersonen und Fachgruppen für Führhund-Angelegenheiten (https://www.dbsv.org/bfh-fachgruppenleiter.html). Manchmal gibt es auch Treffen für Führhundinteressierte, während denen man in das Thema reinschnuppern kann, Infos bekommt, sogar mal ausprobieren kann, wie es sich mit einem Führhund läuft. An diesen Wochenenden hat man die Chance, zwei Tage lang für einen Führhund verantwortlich zu sein und alles einmal ausprobieren zu können. Das würde ich, wenn möglich, auf jeden Fall machen, bevor die ganz konkreten Überlegungen starten. Manche Personen verwerfen nämlich nach solchen Gesprächen und Praxiserfahrungen ihren Plan. Andere fühlen sich nach solchen Kontakten und Begegnungen auch gerade bestärkt, den Weg zu beschreiten.
h.: Wenn ich für mich die Frage beantwortet habe, ob ich einen Führhund haben möchte: Wie wären dann die nächsten Schritte?
J. S.: Führhunde sind, rechtlich gesehen, Hilfsmittel, so wie Blindenlangstöcke, Brillen oder Hörgeräte. Daher ist das Vorgehen eigentlich ähnlich wie bei anderen Hilfsmitteln. Erst einmal brauche ich einen Kostenträger, bei dem ich den Führhund beantrage. Für die meisten ist das ihre gesetzliche Krankenkasse. Im Einzelfall kann auch ein anderer Kostenträger zuständig sein, zum Beispiel die private Krankenversicherung, die gesetzliche Renten- oder Unfallversicherung usw. Die Beantragung läuft aber im Prinzip immer ähnlich ab. Zunächst solltest du dich auf die Suche nach einer geeigneten Führhundschule machen. Das sind Hundetrainer*innen, die Führhunde ausbilden.
h.: Wie finde ich denn eine geeignete Führhundschule?
J. S.: Das ist durchaus knifflig. Führhundschulen gibt es einige. Auf den Seiten des DBSV gibt es eine Übersicht von Schulen (https://www.dbsv.org/fuehrhundschulen.html), aber das sind bei weitem nicht alle. Es wird sicherlich von anderen Führhundhaltenden Tipps geben, mit welchen Schulen gute oder schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Das ist aber natürlich sehr subjektiv. Letztlich muss man das für sich selbst herausfinden. Finde ich die Ausbildungsmethoden gut? Welchen Eindruck macht die Schule? Sind mir die Trainer*innen sympathisch? Sind sie an meiner Motivation interessiert, weswegen ich einen Führhund haben möchte? Fragen sie nach meiner Lebenssituation, dem Wohnumfeld, meinem Alltag? Wie wirken die Hunde auf mich? Es ist sinnvoll, ggf. in Begleitung einer Vertrauensperson zu verschiedenen Schulen hinzufahren und sie sich anzuschauen. Hilfreich kann es auch sein, sich vor einem Besuch zu überlegen, wonach man fragen möchte. Auch dazu gibt es auf der DBSV-Seite Anregungen (https://www.dbsv.org/fragen-an-die-fuehrhundschule.html).
Es empfiehlt sich, bei der gesetzlichen Krankenkasse als Kostenträger nachzufragen, ob sie so genannte Rahmenvertrags-Schulen hat. Einige Kassen schließen – vor allem aus Kostengründen – mit mehreren Führhundschulen Rahmenverträge. In diesem Fall kann die Kasse dich auf diese Schulen verweisen, von denen du dir eine aussuchen sollst. Möchtest du den Führhund von einer Schule, die nicht am Rahmenvertrag deiner Kasse teilnimmt, musst du gut begründen, warum keine der Rahmenvertrags-Schulen für dich passt. Das kann schwierig sein, unmöglich ist es nicht.
Andere Kassen arbeiten ohne Rahmenverträge und schließen Einzelverträge mit Führhundschulen ab.
h.: Wie geht es dann weiter, wenn ich die richtige Schule für mich gefunden habe?
J. S.: Die Schule erstellt dann einen Kostenvoranschlag. Momentan liegen die Kosten für einen Führhund bei circa 40.000, 45.000 Euro und darüber. Dann brauchst du noch eine Verordnung – am besten von einem Augenarzt bzw. einer Augenärztin –, dass du einen Führhund bekommen sollst. Verordnung und Kostenvoranschlag reichst du beim Kostenträger ein. Gut wäre sicher noch, wenn du in wenigen Zeilen begründen würdest, weshalb du einen Führhund benötigst. Dabei kann dir die Führhundschule helfen, auch der Austausch mit Führhundhalter*innen.
h.: Was macht dann der Kostenträger, sagen wir: die gesetzliche Krankenkasse?
J. S.: Er prüft den Antrag. Manche gesetzlichen Kassen entscheiden recht schnell, manche fragen weitere Informationen ab, schalten eventuell den Medizinischen Dienst ein. Der erstellt – meist nach Aktenlage – ein Gutachten, ob das Hilfsmittel Führhund für dich erforderlich ist. Für die Kasse ist entscheidend, ob du allein mit dem Stock gut zurechtkommst oder ob du darüber hinaus einen Führhund unbedingt brauchst. Auf jeden Fall musst du eine Schulung in Orientierung und Mobilität mit dem Langstock nachweisen. Wenn das schwierig ist, etwa weil es schon zu lange her ist, kann es sein, dass die Kasse verlangt, ein Auffrischungstraining zu absolvieren, bevor sie den Antrag auf einen Führhund weiterbearbeitet.
h.: Wie finde ich denn dann eigentlich den passenden Hund für mich?
J. S.: Eine gute Schule wird darauf achten, dass der Hund und du möglichst gut zueinander passen. Sie wird dich sehr gründlich befragen, etwa zu deinen Lebensumständen und Gewohnheiten: Bist du ein eher schneller oder langsamer Läufer? Hast du zusätzliche Beeinträchtigungen? etc. Auf dieser Basis wird sie versuchen herauszuarbeiten, welche Charaktereigenschaften des Hundes gut zu dir und deinem Alltag passen könnten. Andere Schulen stellen dir quasi den Hund bei der Einarbeitungsphase vor die Tür und hoffen, dass ihr gut harmoniert. Das kann durchaus auch mal klappen, muss es aber nicht.
h.: Wie lange dauert es, bis ich meinen Führhund bekomme?
J. S.: In der Regel ist „dein“ Hund, wenn du dich auf den gedanklichen Weg machst, einen Führhund zu beantragen, noch gar nicht geboren. Hast du eine Schule gefunden, kommst du in der Regel auf deren Warteliste. Bis du deinen Führhund bekommst, kann es durchaus mehrere Jahre dauern. Zumal du nicht weißt, wie lang der Genehmigungsprozess läuft, ob du etwa in Widerspruch gehen oder gar klagen musst.
h.: Wenn ich diese ganzen Prozesse bis hin zur Genehmigung durch die Kasse durchlaufen habe und meinen Führhund bekomme – gibt es dann eine Art Katalog von Dingen, die der Führhund können muss, wenn er mir übergeben wird? Oder ist das eher dem Zufall überlassen?
J. S.: Der Führhund muss als Hilfsmittel bestimmten Anforderungen entsprechen. Diese Kriterien sind im Hilfsmittelverzeichnis in der Produktgruppe „Blindenhilfsmittel“ aufgeführt. Dort steht, dass der Führhund die Führleistungen erbringen muss, wie sie im Katalog der Führleistungen des DBSV oder vergleichbarer Organisationen festgelegt sind. Dort steht dann ganz konkret, wie der Führhund an Treppen reagieren sollte oder bei Straßenüberquerungen. Trotzdem ist es natürlich nicht so, dass du dich einfach, wenn du einen neuen Hund bekommst, dranhängen kannst und der Hund erledigt dann alles. Du musst immer bei der Sache sein, dich orientieren, auf den Verkehr achten, wissen, was der Hund macht, und ihm Anweisungen geben. All das übst du mit dem Hund im so genannten Einarbeitungslehrgang. Da wirst du von dem/der Führhundtrainer*in begleitet und angeleitet. Diese Phase dauert mehrere – mindestens zwei – Wochen.
h.: Nach der Einschulungsphase gibt es doch noch die so genannte Gespannprüfung. Was passiert dort?
J. S.: Da werden Mensch und Hund als Team („Gespann“) geprüft. Kann der Führhund, was er können muss? Bleibt er etwa an einem Bordstein stehen? Findet er die Ampel? Geht er nicht auf eine Rolltreppe? Und kann der Mensch den Hund als Hilfsmittel gut nutzen? Reagiert er adäquat auf das, was ihm der Hund zeigt? Gibt er ihm die richtigen Signale? Kann er sich mit dem Hund im Verkehr, in Gebäuden etc. orientieren? Und funktionieren beide als Team? Arbeiten sie gut zusammen?
Das wird von Gespannprüfer*innen begutachtet. Im Optimalfall sind es zwei: ein*e Lehrer*in für Orientierung und Mobilität für blinde und sehbehinderte Menschen und eine Person, deren Fachgebiet meist Hundetraining oder -verhalten ist. Damit keine Interessenkonflikte mit Führhundschulen entstehen, darf die Hundefach-Person kein*e Führhundtrainer*in sein. Beide Prüfer*innen haben aber jeweils Erfahrungen im Fachgebiet des/der jeweils anderen, so dass sie die Prüfung einheitlich beurteilen können.
Die Gespannprüfungen werden von den Kostenträgern beauftragt. Es kommt vor, dass Führhundschulen den Kassen bestimmte Prüfer*innen empfehlen, was schwierig ist. Manchmal wird auch nur eine prüfende Person beauftragt, wodurch vielleicht nicht immer beiden Aspekten – Orientierung und Mobilität des Menschen und Verhalten des Hundes – hinreichend Rechnung getragen wird. Manche Schulen lehnen bestimmte Prüfende ab, viele die Gespannprüfung in ihrer aktuellen Form insgesamt. Das ist ein ziemliches Spannungs- und Diskussionsfeld.
h.: Sind die Führhundschulen denn eigentlich so lange dein Ansprechpartner, wie du deren ausgebildeten Hund als Führhund nutzt?
J. S.: Im Idealfall schon. Die Ausbilder*innen kennen die Hunde gut. Sie sollten deshalb die ersten Ansprechpersonen bleiben, wenn Halter*innen Fragen haben oder wenn es Probleme mit dem Hund gibt. Und viele Trainer*innen möchten schon wissen, wie es Mensch und Hund geht, optimalerweise bis der Hund nicht mehr arbeitet oder bis zum Lebensende. Aber der Kontakt hält manchmal nicht, aus unterschiedlichsten Gründen.
Schwierig kann es werden, wenn das Hilfsmittel Führhund früher oder später nicht so „funktioniert“ wie gedacht, etwa Hindernisse nicht mehr umgeht, nicht am Bordstein stehenbleibt oder Tiere jagen möchte. Es kommt manchmal zu Diskussionen, wer oder was dafür verantwortlich ist: Sind es Mängel in der Ausbildung durch die Schule, hat der/die Halter*in im Alltag mit dem Hund Fehler gemacht? Es kann schwer sein, die Ursächlichkeit zu klären. Ein solcher Konflikt kann das Vertrauensverhältnis zwischen Führhundschule und -halter*in sehr belasten.
h.: Vielleicht kannst du uns bei einem recht häufigen Thema weiterhelfen. Darf ich meinen Führhund überall hin mitnehmen und wo gibt es Ausnahmen von dieser Regel?
J. S.: Es gibt seit 2021 das Recht auf Zutritt von Menschen mit Behinderung in Begleitung ihrer Assistenzhunde. Das steht in § 12e Absatz 1 Behindertengleichstellungsgesetz. Es gilt für Bereiche, die üblicherweise für den regulären Publikums- und Benutzungsverkehr offen sind. Einfacher gesagt: Überall dort, wo man in normaler Straßenkleidung (ohne Spezialkleidung) und ohne besondere Erlaubnis rein darf. Also: Verkaufsraum im Supermarkt, Gastraum im Restaurant, ärztliches Behandlungszimmer, aber nicht: Intensivstation, Restaurantküche, Lebensmittel-Produktionsstätte etc.
Zutrittsverweigerungen pauschal zu begründen, etwa wegen der Hygiene, ist in der Regel unzureichend. Auf berechtigte Interessen, wie bei starken Phobien oder Allergien, muss Rücksicht genommen werden. Dann müssen Lösungen her, die allen gerecht werden. Der Verweis auf das Hausrecht zieht an der Stelle ebenfalls meist nicht. Das Hausrecht darf nicht ausgeübt werden, wenn dadurch eine behinderte Person unzulässig diskriminiert wird. Die Führhunde sind auch auf adäquates Verhalten, beispielsweise im Supermarkt, trainiert, und es liegt in der Verantwortung der Haltenden, dass der Hund sich auch so verhält. Wenn das Gemüseregal leergefressen wird, ist das eindeutig ein Fehlverhalten. Dann wäre der Verweis aus dem Laden wohl gerechtfertigt.
Eine andere Frage ist, wo ich den Hund überhaupt mitnehme und wo nicht. Als Halter*innen müssen wir im Sinne des Tierschutzes handeln. Deswegen darf ich den Hund etwa keinem unzumutbaren Stresspegel aussetzen. Sagen wir sehr laute Konzerte oder übervolle Stadtfeste. Vom Zutrittsrecht mag das eventuell gedeckt sein. ich muss nur überlegen, ob ich das meinem Hund auch zumuten kann und möchte. Da sollte das Interesse am Hilfsmittel Hund hinter dem Interesse des Lebewesens Hund zurückstehen. Das gilt auch dann, wenn ich langsam merke, dass mein Hund älter wird und ihm die Führarbeit schwerer fällt.
h.: Zum Schluss: Was würdest du dir in Sachen Führhunde für die Zukunft wünschen?
J. S.: Ein Wunsch wären verbindliche Standards für die Aus- und Weiterbildung von Führhundetrainer*innen. Ansätze dazu gibt es schon, aber da ist noch eindeutig Luft nach oben. Ziel wäre, dass alle Trainer*innen ungefähr den gleichen Wissensstand hätten und ungefähr nach den gleichen Standards arbeiten. Das wäre ein großer Schritt nach vorne.
Beim Thema Zutrittsrechte würde ich mir wünschen, dass eine unzulässige Verweigerung effektiver verfolgt werden kann. Es gibt eine Schlichtungsstelle und wir können klagen. Das ist gut und wichtig. Aber ein solcher Verstoß sollte nicht nur von uns behinderten Menschen durchgesetzt werden müssen. Er sollte als Ordnungswidrigkeit gewertet und geahndet werden können. So wie das jetzt schon bei einer Mitnahmeverweigerung in einem Taxi oder einem anderen Verkehrsmittel möglich ist.
Von der Politik würde ich mir auch wünschen, dass die Anstrengungen intensiviert werden, das Thema Assistenzhunde noch mehr in die Köpfe und in die Gesellschaft zu tragen. Mit dem Gesetz, das die Zutrittsrechte regelt, wurde schon ein wichtiger Schritt vollzogen. Die Aufklärung über das Thema wird aber bislang eher nur den Selbsthilfeverbänden wie DBSV oder DVBS überlassen. Da wäre ein bisschen mehr politische Unterstützung und Rückendeckung hilfreich und willkommen.
Zur Person
DVBS-Mitglied Johannes Sperling ist stellvertretender Referent für Führhund-Angelegenheiten im Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin sowie aktiv im DBSV-Arbeitskreis der Führhundhaltenden. Nach seinem Abitur an der blista und einem Jura-Studium in Marburg hat er Skandinavistik mit Nebenfach Jura (M.A.) in Berlin studiert. Er setzt sich seit Jahren für die Rechte von Assistenzhundehaltenden ein und hat die Einführung von Regelungen im Behindertengleichstellungsgesetz sowie der Assistenzhundeverordnung begleitet.
Bild: Johannes Sperling hat blaue Augen, kurze braune Haare und einen Vollbart. Er trägt ein weinrotes Poloshirt. Auf der Außenaufnahme dreht er seinen Oberkörper leicht den Betrachtenden zu. Foto: privat
Mit sechs Beinen geht es besser oder: Warum blinde Menschen auf den Hund kommen. Mirien Carvalho Rodrigues im horus-Interview mit Peter Beck
Seit Jahrtausenden gibt es eine enge Verbindung zwischen Menschen und Hunden. Wem zuerst einfiel, einen Hund zum Führen eines blinden Menschen abzurichten, bleibt im Dunkeln. Aber es ist lange her, denn schon in der Straßburger Bettelordnung steht ums Jahr 1500, dass Bettler fortan keine Hunde mehr haben sollen, es sei denn, sie seien blind und bräuchten daher einen. Aha!
Ende des 18. Jahrhunderts dürften in einem Pariser Blindenhospital erstmals systematisch Führhunde ausgebildet worden sein. Und 1813 erfahren wir von einem Wiener Augenarzt, es habe sich ein junger blinder Mann einen Spitz zum Führhund trainiert.
In Deutschland wurden Führhunde ab 1916 in Oldenburg ausgebildet, wurden doch im Ersten Weltkrieg viele Soldaten an den Augen verletzt. Potsdam folgte 1923. Und ab den 1950er-Jahren wird die Landschaft deutscher Führhundschulen recht unübersichtlich.
Aber weg von der Historie. Warum binden sich blinde Frauen und Männer an einen Hund? Das wollte der horus von Mirien Carvalho Rodrigues wissen. Die 56-jährige Übersetzerin und Schriftdolmetscherin verlässt sich seit Jahrzehnten auf ihre Führhunde.
horus: Wann und warum hast du dich für einen Hund entschieden?
Mirien: Ich bin jetzt beim dritten Führhund. 1999 hatte ich den Ersten. Die Entscheidung, einen Führhund zu wollen, dauerte etwa zwei Jahre. Ich bin gern unterwegs und mag Tiere. Die wichtigste Frage damals war: Kann und will ich mit irgendeinem Lebewesen rund um die Uhr zusammen sein? Und ich kam zu dem Schluss, dass es mit einem Hund gehen könnte - obwohl ich nie Hunde hatte. Danach machte ich mich auf die Suche nach dem richtigen Hund für mich.
h.: Wie hast du den Hund für deinen Typ gefunden, es gibt ja haufenweise Führhund-Schulen?
M.: Ich habe mir nur zwei oder drei angesehen und bin Probe gelaufen. Natürlich wusste ich anfangs Vieles nicht. Und als dann der Jack vor mir stand, war er einfach der richtige Hund. Die Trainerin hat in Vorgesprächen zu ergründen versucht, welcher Hund passt: Ich bin viel unterwegs, bin an unterschiedlichsten Orten, und die Trainerin überlegte auch, welches Tier passt zu einer Erst-Halterin.
h.: Wie muss ein Hund sein, der deinem Typ entspricht?
M.: Er darf sich über nichts wundern. Es gibt so viele Kriterien, beginnend mit dem Lauftempo, damit der Hund nicht immer zieht oder mich ausbremst. Ich brauchte einen Hund, dem es egal ist, für längere Zeit in Konferenzsälen zu liegen, der aber andererseits locker durch den Hamburger Hauptbahnhof oder den Frankfurter Flughafen führt, als wäre er da auch zu Hause. Von meinem ersten Hund habe ich mehr gelernt als von allen Trainerinnen zusammen. Der war megaschlau, er hat mir durchaus auch gezeigt, was passiert, wenn ich nicht konsequent mit ihm bin. Denn dann testet der Hund, wer im Gespann der Chef ist. Ich wusste am Anfang, dass es Hörzeichen gibt, auf die hin der Hund eine Treppe, eine Tür oder ein Fahrzeug ansteuert. Aber der Hund hat mich gelehrt, dass er sehr viel mehr kann und ein unglaubliches Orientierungsvermögen mitbringt. Wenn man versteht, dieses zu nutzen, kann man als Team wunderbare Dinge erleben.
h.: Hast du ein Beispiel?
M.: Ich erinnere mich an eine Busfahrt in Heidelberg, damals eine neue Stadt für mich. Die Ansage im Bus ging falsch und ich stieg eine Station zu spät aus, dachte aber, ich sei richtig. Als mir der Irrtum klar wurde, dachte ich nach, wie ich jetzt laufen sollte. Der Hund aber reagierte ganz gelassen und lief los. Ich ließ mich darauf ein und wir landeten an einer geriffelten Gummimatte vor meiner Bank, denn das war einer der wenigen Orte, die wir zum damaligen Zeitpunkt kannten. Und von dort aus konnte ich mich dann wieder orientieren. Das war ein grandioses Erlebnis, denn damals konnte ich noch kein Navi-System fragen, wo ich mich gerade befinde.
Bei technischen Geräten gibt es die Backtrack-Funktion, der Hund hat die auch. Wenn ich meinetwegen eine Station der Frankfurter U-Bahn verlasse und mit einer Wegbeschreibung ein Ziel ansteuere, kann mich der Hund hinterher genau zur selben U-Bahn-Treppe zurückführen. Voraussetzung ist natürlich, dass es in dieser Gegend keinen anderen Ort gibt, den ich kenne und wohin ich eventuell wollen könnte.
Solche wunderbaren Erlebnisse kann man haben, wenn die Bindung stimmt und man sich selbst und dem Hund diese Fähigkeiten zutraut.
h.: Ist ein Hund in erster Linie Haustier, Freund oder Hilfsmittel?
M.: Gut, dass ich mich da nicht entscheiden muss. Wir sind beide Teil eines Sechs-Pfoten-Teams. Unterwegs ist er Mobilitätshilfe und Begleiter, zu Hause ist er Hund. Wenn ich's gewichten müsste, müsste ich mich fragen, ob ich wohl einen Hund nur als Haustier haben wollte. Wahrscheinlich nicht, also kommt die Mobilitätshilfe schon recht weit vorn. Natürlich muss ich mir klar darüber sein, welche Bedürfnisse der Hund hat: Er muss raus bei Wind und Wetter, er braucht Zuwendung, Futter, also Zeit. Und das hat alles mit der Frage vom Anfang zu tun: Bin ich bereit, meinen gesamten Tag mit einem anderen Lebewesen zu teilen und Verantwortung zu tragen?
h.: Könnten alle blinden Menschen einen Führhund haben?
M.: Wer volle Arbeitstage in einer Innenstadt hat und fast jeden Abend in die Disco gehen möchte, hätte zwar vermutlich viel Führarbeit für den Hund, aber einen Lebensstil, zu dem täglicher Auslauf und Kontakte zu anderen Hunden nicht passen.
Und da sind wir beim nächsten entscheidenden Punkt: Es muss genügend Arbeit für den Hund geben. Die blinde Person muss also regelmäßig allein Wege zurücklegen, auf denen sie den Führhund als Mobilitätshilfe einsetzt und braucht. Im einzelnen kann sich das natürlich stark unterscheiden. Manche gehen täglich dieselben Wege, andere sind an wechselnden Orten unterwegs. Deshalb ist es so wichtig, den richtigen Hund für jeden Menschen zu finden.
h.: Wie wichtig ist eine gute eigene Orientierung für das Gehen mit einem Führhund?
M.: Ich habe keinen guten Orientierungssinn. Mit Himmelsrichtungen fange ich nichts an, ich lerne meine Wege auswendig. Aber natürlich muss ich wissen, wo ich bin, da ich dem Hund sagen muss, wohin es gehen soll. Also rechts abbiegen, links eine Haltestelle oder Ampel suchen. Anders als beim Gehen mit dem Stock mache ich mit dem Hund nicht mehr Bekanntschaft mit jedem Schild oder Fahrradständer. Und auch die vielen abgestellten E-Scooter sind für mich gar nicht da. Ich bin auch schneller unterwegs als mit dem Stock. Am Anfang war ich an meinem Ziel oft schon vorbei, wenn ich mir dachte, es müsste jetzt mal kommen. Da Hunde neugierig sind, zeigen sie mir auch immer mal was Neues, worauf ich selbst nie gekommen wäre. Vorzugsweise Metzgereien und Würstchenbuden.
h.: Verliere ich die Fähigkeit, mich selbst zu orientieren, wenn ich lange Zeit mit einem Hund gegangen bin?
M.: Ich habe nie verlernt, mich mit dem Langstock und anhand meiner Sinne zu orientieren. Allerdings merke ich, wie viel entspannter und schneller ich mit dem Hund laufe und welche Anstrengung es kostet, wenn E-Roller, Fahrräder und Schilder plötzlich wieder überall im Weg stehen oder ich lange nach Eingängen tasten muss.
Was schon passieren kann, ist, dass ich mich etwa auf einem großen Platz nicht mehr zurechtfinde, den ich mit dem Führhund zielsicher überqueren konnte. Nur hätte ich das ohnehin mit Langstock nicht oder nur auf Umwegen hinbekommen.
Wo ich ohne Führhund mittlerweile extrem unsicher bin, ist tatsächlich auf Bahnsteigen. Das liegt aber vermutlich eher daran, dass ich früher mit einem minimalen Sehrest erahnen konnte, wie weit die Bahnsteigkante entfernt ist.
h.: Gibt es irgendwelche Nachteile, wenn du mit einem Hund unterwegs bist?
M.: Klar, mit der Verantwortung kommen Aufgaben. Der Hund kann krank werden, dann muss umgeplant werden. Auf Reisen muss ich überall einen Platz finden, an dem der Hund sein Geschäft machen kann, und Zugfahrten von acht Stunden oder mehr machen eben auch Probleme. Das könnte man als Nachteil werten. Ich bin mit meinen Hunden auch geflogen, teils bis Brasilien. So etwas kommt überhaupt nur in Betracht, weil der Führhund bei mir in der Kabine liegen darf und nicht im Frachtraum transportiert wird. Ich würde meinen Hund aber nicht mitnehmen, wenn ich eine solch weite Reise nur für eine Woche mache.
h.: Gibt es Lebenssituationen oder Wohnverhältnisse, in denen ein Hund schwer zu halten ist?
M.: Ich persönlich fände es schwierig, wenn ich in einer Großstadt für jeden Hundegang erst einmal eine halbe Stunde mit der Straßenbahn fahren müsste. Seit ich Führhunde habe, habe ich immer sehr nahe an Wald, Feld oder Park gewohnt. Wenn man die Zeit hat und je nachdem, wie wichtig es einem ist, kann man aber sicher vieles einrichten.
Jedoch werden alle Schwierigkeiten, denen ich begegnet bin, vielfach aufgewogen durch die Unabhängigkeit, die ich bekomme, wenn ich zum Beispiel auf einem Weg auch mal vor mich hinträumen kann, was mit Stock kaum geht, wenn mein Hund ganz selbstverständlich den Ausgang aus einem fremden Supermarkt oder Bahnhof findet, oder wenn ich mit ihm im Führgeschirr eine lange, gerade Strecke einfach mal richtig entspannt sausen kann. Selbst im Schnee, wo sich blinde Menschen zuweilen jeglicher Orientierungspunkte beraubt finden, kann ich darauf vertrauen, dass mein Führhund mich sicher ans Ziel bringt.
All das gilt für ein gut eingespieltes Team. Wenn ich mir einen neuen Stock hole, geht es ebenso weiter wie mit dem bisherigen. Beim neuen Hund fängt alles von vorne an. Es gibt noch keinen USB-Stick, mit dem ich die Fähigkeiten und Erkenntnisse, die ich mit dem alten Hund gewonnen habe, einfach auf den neuen übertragen kann. Hunde werden einfach nicht so alt. Sie führen im Schnitt sieben bis acht Jahre. Dann kommt ein Wechsel und ein Abschied, und das strengt schon an, und mancher sagt sich dann, „Das schaffe ich nicht mehr, ich will jetzt keinen Hund mehr". Das ist sicher der größte Nachteil.
h.: Es gibt viele Führhundehalter, die behaupten, der Hund baue ihnen Brücken zu anderen Menschen. Würdest du das auch sagen?
M.: Mehr Kontakt hat man auf jeden Fall. Es gehört zum Leben, regelmäßig bei flüchtigen Begegnungen zu erklären, dass der Hund im Dienst ist und nicht durch Ansprache oder Streicheln abgelenkt werden darf. Manchmal kommt es zu kuriosen Situationen. Einmal fragte ich jemanden nach dem Weg, und er stellte sich vor meinen Hund, zeigte in eine Richtung und erklärte ihm: Da musst du dein Frauchen hinführen.
Aber es ist auch was dran am Brückenbauen. Über den Hund finden viele sehende Personen, die sich sonst nicht trauen würden, mich anzusprechen, einen Einstieg. Dadurch sind schon mehrfach richtig gute Urlaubsbekanntschaften entstanden. Und ich habe insgesamt mehr Gelegenheiten, selbst herauszufinden, ob ich mit jemandem kann oder nicht.
h.: Wie sind denn die Menschen auf deinen Reisen mit euch als Gespann umgegangen. Gab es da Unterschiede zu Deutschland?
M.: In Brasilien hatten wir das Glück, dass zu der Zeit, als wir ankamen, gerade eine tägliche Telenovela gezeigt wurde, in der ein Führhundhalter eine große Rolle spielte. Und plötzlich war da ein echter Führhund mit seiner Halterin, und das Hallo war groß, dass es das nicht nur im Fernsehen gibt. In Brasilien wird man ohnehin häufiger angesprochen und nicht nur beobachtet. Teilweise haben sich die Taxifahrer darum gestritten, wer uns fahren dürfe. Wahrscheinlich haben die dann zu Hause ihren Kindern und Enkeln erzählt, dass sie einen richtigen Führhund an Bord hatten – wie im Fernsehen.
Grundsätzlich habe ich dort nach einem Tipp von Einheimischen nie vorher angekündigt, dass ich mit Führhund komme. Hätte ich das getan, hätte es oft geheißen: Kennen wir nicht, sind wir nicht drauf eingestellt. Wenn du aber plötzlich mit dem Hund auftauchst, dann ist alles einfach, alle sind begeistert und es wird improvisiert, denn darin sind die Menschen in Brasilien einsame Spitze. Und dann bekam ich auch schon mal im Hotel das größte Zimmer, obwohl es eigentlich schon belegt war, weil der Hund ja auch Platz braucht. Ablehnung habe ich in Brasilien kaum erlebt.
h.: Du schreibst derzeit an einem Buch, in dem dein erster Hund Jack den Erzähler gibt.
M.: Mein erster Führhund schreibt aus seiner Perspektive über seine Erlebnisse mit mir. Das wird kein Ratgeber-Buch, sondern ein humorvoller Text über Teilhabe und Inklusion, von Hunden und Menschen. Es sind kurze, abgeschlossene Episoden. Und nebenbei kann man beim Lesen lernen, dass blinde Menschen ein durchaus normales Leben führen mit Reisen, mit Freizeit und Arbeit. Mein Hund kann vieles mit einem Augenzwinkern sagen, was man mir vielleicht übel nähme, ihm aber nicht.
h.: Also wer dich kennenlernen möchte, muss deinen Hund fragen.
M.: Ja, aber alles verrät er auch nicht. Hunde können Dinge für sich behalten, die sie über einen wissen.
h.: Wie kann man das Buch bekommen?
M.: Das Buch soll als E-Book und Taschenbuch und im Idealfall auch als Hörbuch erscheinen. Hoffentlich finde ich eine Stimme, die so klingt wie mein erster Hund.
Zur Person
Mirien Carvalho Rodrigues arbeitet als Dolmetscherin, Übersetzerin und Schriftdolmetscherin für Englisch, Portugiesisch und Deutsch. Die 56-Jährige liebt Reisen und ist seit 25 Jahren mit Führhund unterwegs. Im DVBS engagiert sie sich
Bild: Mirien Carvalho Rodrigues hat glattes, hellblondes Haar und graugrüne Augen. Sie trägt ein Shirt in Türkis. Foto: DVBS
Bildcollage: Hunde haben Bedürfnisse und sind neugierig. Unar, ein schwarzer Labrador Retriever, sitzt im Führhundgeschirr auf einem öffentlichen Platz, hinter ihm steht Mirien Carvalho Rodrigues, die seine Leine hält. Mensch und Hund blicken in die gleiche Richtung (li). Beide stehen am Metzgerwagen. Unar stützt zwei Vorderpfoten auf den schmalen Tresen, so dass er groß genug ist, um in die Auslage zu blicken (o.r.). Unar wartet in Sitzposition vor dem Metzgerwagen auf das Ende des Einkaufs. Im Hintergrund der Aufsteller „Frikadelle Stck 1,-“ (u.r.). Fotos: privat (2020)
Tauben in der Stadt - von Tierschutz ist selten eine Rede. Marion Happe im horus-Interview mit Sabine Hahn
Über das harte Leben der Stadttauben und eine sinnvolle Hilfsmaßnahme
horus: Du unterstützt häufig Initiativen für den Tierschutz. Lass uns heute über Tauben reden. Stadttauben haben kein gutes Image, niemand will sie haben, auch auf dem Markusplatz in Venedig nicht. Warum?
Marion Happe: Tauben gegenüber gibt es eine große Ambivalenz. Stadttauben vermehren sich relativ schnell. So kann es zu recht großen Populationen in den Städten kommen, und das nervt die Menschen. Dabei muss man aber wissen, dass das Brutverhalten, das häufige Eierlegen der Stadttauben, menschengemacht ist, es wurde ihnen angezüchtet. Die Vorfahren der Stadttauben waren Felsentauben. Die wurden domestiziert und gehalten, damit sie Fleisch- und ergiebige Eierlieferanten wurden. Die Menschen haben von ihnen profitiert.
h: Kann man sagen, dass die Tauben Nutztiere waren?
M. H.: Ja, sie waren Nutztiere. Heute würde man die Stadt- bzw. Straßentauben als Kulturfolger bezeichnen. Es ist so, dass Tauben auf der einen Seite geachtet werden, etwa als Friedenssymbol, als wunderschöne weiße Tauben bei Hochzeiten, als Rasse- oder Brieftauben, für die hohe Summen ausgegeben werden. Andererseits ist eine Taube ein Nichts und wird wie Abfall behandelt, wenn sie im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße landet, etwa weil sie sich als Brieftaube verfliegt und so zur Stadttaube wird.
h: In der Stadt sind Tauben oft auch aus hygienischen Gründen nicht willkommen.
M. H.: Viele glauben, dass Tauben große Krankheitsüberträger wären. Aber das sind sie gar nicht. Sie sind ganz normale Vögel, die genauso viele oder wenige Krankheiten wie andere Vögel übertragen. Extrem diskriminierend ist z. B. der Begriff „Ratten der Lüfte“ für Tauben. Tauben nehmen den Menschen nichts weg, nagen nichts an und werden nicht aggressiv. Es ist nur so, dass der Kot recht ätzend ist, Gebäude verschmutzt und Denkmäler angreift.
h: Kann man Tauben daran hindern, sich an bestimmten Orten niederzulassen, z. B. durch Taubenabwehr-Spitzen, diese kurzen dünnen Metallstäbe auf Fenstersimsen?
M. H.: Das halte ich für Tierquälerei. Das einzige, was wirklich hilft, ist ein Stadttaubenmanagement. Es besteht darin, an sogenannten Hotspots, also dort, wo viele Tauben sind, Taubenschläge zu errichten. Dort ziehen die Tauben ein – es wird ihnen schmackhaft gemacht, indem sie dort gutes Futter bekommen, artgerechtes Körnerfutter. Wird der Taubenschlag von ihnen angenommen, schlafen sie auch dort, koten dort ab und – ganz wichtig – sie brüten dort. Dann kann dort eine Geburtenkontrolle stattfinden: Die Eier werden weggenommen und durch Gips-Eier ersetzt. Die Tauben werden quasi hinters Licht geführt. Ihre Population kann dadurch kleiner gehalten werden. Die Taubenschläge müssen natürlich betreut werden, ehrenamtlich oder durch Angestellte der Stadt.
h: Gibt es positive Beispiele von Städten mit einem Taubenmanagement?
M. H.: Ja, z. B. Aachen, Augsburg oder Mainz. Dort gibt es diverse Taubenschläge und Ansprechpersonen bei Fragen zu den Stadttauben. Im Endeffekt ist das Taubenmanagement für Städte günstiger, als die Verschmutzungen an Gebäuden zu entfernen.
h: Du selbst hast ja auch schon versucht, ein Taubenmanagement für die Stadt Marburg zu initiieren. Wie bist Du vorgegangen?
M. H.: Seit 15 bis 20 Jahren bemühe ich mich sehr, den Stadttauben zu helfen. Es ist aber leider ein Fass ohne Boden. Anfangs habe ich umfangreiches Informationsmaterial zum Thema Stadttaubenmanagement ins Rathaus gebracht, mit der Bitte, es an den Bürgermeister weiterzuleiten. Da ist gar nichts passiert. Einige Jahre später hatte ich einen persönlichen Termin beim Oberbürgermeister. Er hat meine mitgebrachten Materialien, darunter waren DVDs und ausführliche Anleitungen, wie Taubenschläge sachgemäß errichtet werden sollten, innerhalb der Stadtverwaltung weitergeleitet. Als ich telefonisch nachgefragt habe, war schon die Hälfte der Materialien nicht mehr auffindbar. Später habe ich an einer Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung teilgenommen. Dort wurde meine Frage bezüglich eines Taubenmanagements in Marburg abgebügelt, nein, wir machen nichts für die Tauben.
Seit einem Jahr bin ich nun Mitglied der Stadttaubeninitiative Mittelhessen „Columba Livia“. Wir haben uns gemeinsam bemüht, nochmals mit der Stadt in Kontakt zu treten, um einen Taubenschlag zu errichten. Als Standort kam das Rathaus in Betracht, aber die Verantwortlichen haben sich gesperrt und wollten auch keine weitere Info-Veranstaltung. Gerne hätten wir darüber aufgeklärt, dass dem Rathausgebäude nichts passieren würde, wenn der Taubenschlag sachgemäß angebracht würde. Auf meinen Vorschlag hin, den Bahnhof oder umliegende Häuser als Standort für einen Taubenschlag in Erwägung zu ziehen, bekam ich bisher keine Antwort.
Ich habe öfter mit der Unteren Naturschutzbehörde telefoniert, aber auch das hat leider nichts bewirkt. Es gab zwar eine gemeinsame Begehung von Mitgliedern von Columba Livia mit Verantwortlichen der Stadt, um einen möglichen Standort für einen Taubenschlag zu besichtigen. Aber dabei ist leider nichts Konkretes herausgekommen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass all meine Bemühungen der letzten 20 Jahre komplett ins Leere gelaufen sind. Die Stadt Marburg tut schlicht und ergreifend nichts für die Tauben. Das Taubenfütterungsverbot schadet den Tieren.
h: Was bedeutet das?
M. H.: Das Taubenfütterungsverbot ist in der städtischen Gefahrenabwehrverordnung festgelegt. Auch andere Städte haben das, z. B. Hamburg, so kann ein Bußgeld bis 5.000 Euro verhängt werden, wenn jemand Tauben im Stadtgebiet füttert. Das führt aber dazu, dass die Tauben den letzten Mist fressen, z. B. Kuchenreste, Pommes oder Brötchen. Für mich gibt es nur die Lösung Stadttaubenmanagement mit artgerechtem Futter.
h: Wie sicher leben Tauben in der Stadt, wie funktioniert ihr Schutz?
M. H.: Damit sieht es katastrophal aus. Jüngstes Beispiel, das mich und viele andere sehr verzweifeln lässt, ist die Stadt Limburg. In Limburg gibt es angeblich 700 Stadttauben. Durch ein missverständlich formuliertes Bürgerbegehren haben mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger dafür gestimmt, dass die Tauben durch einen Falkner getötet werden sollen. Die Stadt will die Population auf ungefähr 300 Tauben senken. Dagegen gab es großen Protest, man hat wohl versucht, Lösungen zu finden, z. B. 200 der Tauben einzufangen und sie im Gut Aiderbichl, einem Gnadenhof, unterzubringen. Aber das ist teurer als von der Stadt geplant, und nun soll wieder eine Ausschreibung zum Einfangen und Töten der Tauben kommen – 200 Tiere sind zunächst betroffen.
h: Es gibt viele Tauben, die humpeln oder verletzte Flügel haben.
M. H.: Ja, viele Stadttauben sind sehr schwach und extrem hungrig. Sie rennen allem hinterher, was auf dem Boden liegt, achten nicht auf die Gefahren, wie Busse, Autos oder Fahrräder, und werden angefahren. Es gibt auch mutwillige Verletzungen durch Menschen. Tauben werden oft getreten. Ich weiß von einem schlimmen Fall, wo einer Taube eine Gabel in den Rücken gerammt wurde, nur weil sie im Außenbereich eines Cafés herumgelaufen ist. Die Stadttauben leben auch nicht lange, ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei zwei bis drei Jahren, eigentlich können Tauben bis 10 Jahre alt werden. 90 Prozent der Stadttauben sterben im ersten Lebensjahr.
h: Welche Tipps hast Du für diejenigen, die sich für ein Taubenmanagement einsetzen wollen?
M. H.: Ich würde mich mit Tierschutzvereinen zusammentun, z. B. mit Stadttaubeninitiativen oder Organisationen wie dem NABU oder Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner. Die haben viel Informationsmaterial und auch Filme auf DVD zum Thema Stadttaubenmanagement.
h: Wie ist Deine Erfahrung als Sehbehinderte bei der Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen, gibt es Barrieren?
M. H.: Naja, für Seheingeschränkte ist es natürlich komplizierter als für Sehende, von hier nach dort zu kommen, um sozusagen im Außendienst für den Tierschutz tätig zu sein. Ich mache fast alles von Zuhause aus. Ich bin Fördermitglied in drei Tier- und Naturschutzorganisationen und spende auch monatlich für das Marburger Tierheim. Ich unterschreibe diverse Petitionen für die Tiere und leite die Newsletter der Organisationen an Freunde und Bekannte weiter. Die Mitarbeit an Infoständen oder die Teilnahme an Demonstrationen sind nichts für mich.
h: Welche Erfahrung hast Du selbst mit Tauben gemacht, was fasziniert Dich an den Tieren?
M. H.: Ich finde, das sind sehr friedliche, freundliche Tiere. Allein die Tatsache, dass Stadttauben so gehasst werden, empfinde ich als extrem ungerecht. Das ist ein Grund, warum ich mich für Tauben einsetze, auch weiterhin.
Tiere mochte ich schon immer. Ich war bereits als Kind stark seheingeschränkt. Mein Vater hat in unserem Garten eine Voliere für mich gebaut. Dort gab es Hasen, Zwerghühner und Tauben. Ich habe viele Stunden dort bei meinen Tieren verbracht. Ich habe den Tauben Namen gegeben, sie saßen auf meiner Hand, auf der Schulter, auf dem Kopf; ich habe sie gefüttert und konnte sie kraulen. Ich fand zum Beispiel total faszinierend, wie mein Lieblingstäuber namens Peter gebalzt hat. Er war sehr zahm, saß auf meiner Hand, und hat mit „Guurukku“ seinen Hals und sein Köpfchen nach vorne gewippt. Es waren so liebe, freundliche Tiere. Nie bin ich durch sie krank geworden.
h: Wie kommunizierst Du mit den Tauben?
M. H.: Indem ich langsame, vorsichtige Bewegungen mache, nicht zu laut spreche, und versuche, Ruhe auszustrahlen.
h: Welche Tipps kannst du anderen Sehbehinderten geben, um Tauben zu beobachten?
M. H.: Geht auf Marktplätze, dort gibt es viele Tauben, oder geht an Flüsse, an Stellen, wo Enten und Schwäne gefüttert werden. Nehmt nicht irgendwelchen Schrott zum Taubenfüttern mit. Taubenfüttern in der Stadt darf ich natürlich nicht weiterempfehlen, es ist ja strafbar, was ich so absurd finde. Aber Tauben sind für gutes Futter äußerst dankbar. Sie kommen bis auf ein paar Zentimeter näher. Hört zu, wie die Tauben gurren. Die Laute der Stadttauben sind von denen der größeren Ringeltauben sehr gut zu unterscheiden. Männliche Tauben machen andere Laute als weibliche.
Tauben sind wundervolle Tiere, genauso liebenswert wie Amsel, Drossel, Fink und Star.
h: Vielen Dank für das Gespräch.
Zur Person
Marion Happe (60) ist blista-Alumna und arbeitet als Telefonserviceassistentin bei der Bundesagentur für Arbeit. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Hündin Surina, einer ehemaligen rumänischen Straßenhündin, in Marburg.
Bild: Marion Happe blickt lächelnd nach links. Sie hat lockiges, dunkelblondes Haar und blaugraue Augen. Im Hintergrund wächst lichter Laubwald. Foto: privat.
Bild: Beziehungsaufbau: Ein kleines Mädchen kniet ruhig auf einem gepflasterten Platz und wendet sich Tauben zu, die erwartungsvoll nahe herangelaufen sind und auf dem Boden nach Futter picken. Das Mädchen mit geflochtenem Zopf und rosa Kapuzenshirt ist nur von hinten sichtbar. Foto: pixabay / Alicja
M. Herrmann: Ein Leben ohne Pferd ist möglich, aber sinnlos! Frei nach Loriot
Ohne Tiere möchte ich nicht leben!
Von Mirjam Herrmann
Mein Name ist Mirjam Herrmann, wohnhaft in Neustadt an der Weinstraße in der schönen Pfalz, auch „Die Toskana Deutschlands“ genannt. Geboren bin ich im Jahr 1964, und im Jahr 1967 erblindet aufgrund eines Geburtsfehlers.
Seit ich denken kann, begleiten Tiere, insbesondere Hunde und Pferde, mein Leben. Dies begann im frühesten Kindesalter mit den Tieren meiner Großeltern, die ihren Lebensunterhalt mit Landwirtschaft, Weinbau und Viehwirtschaft verdienten. Die Arbeitspferde waren dabei meine erklärten Lieblinge. Das „Pferdevirus“ hat mich seither nicht mehr verlassen. Insbesondere als meine Schwester ein eigenes Reitpferd bekam, auf dem ich ab und zu auch einmal sitzen durfte, löcherte ich meine Eltern, dass ich ebenfalls gerne reiten wollte. Ab und an durfte ich dann in Begleitung meiner Eltern auf einem Ponyhof in unserer Nähe in den Sattel steigen.
Während eines Urlaubs meiner Mutter und Schwester ergriff mein Vater die Gelegenheit beim Schopf und fuhr eines Sonntags im April 1974 mit mir zu dem erwähnten Ponyhof, um ein geeignetes Pony für mich zu kaufen. Man wurde schnell einig und zwei Tage später stand das Pony bei mir im Stall. Ich war stolz wie Oskar!
Nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub staunte meine Mutter nicht schlecht, als sie den schwarzen Ponykopf aus der Stalltür lugen sah!J Sie hat dann aber ziemlich schnell ihre Bedenken gegen meine Pferde- und Reitbegeisterung sowie gegen das Pony abgelegt.
Vier Jahre später begann die Ära der Großpferde, da ich für das Pony zu groß geworden war. Über einen Zeitraum von fast 51 Jahren hatte ich elf Pferde/Ponys. Aktuell habe ich einen englischen Vollblut-Wallach sowie eine betagte Welsh-Ponystute im Stall.
Das Reiten lehrte mich meine Cousine, die damals schon Turnierreiterin war. Sie vermittelte mir die Grundlagen der Reiterei, d. h. Reiten in der Bahn (einfache Dressurlektionen sowie das Springen über Kavalettis und kleinere Hindernisse, welche rings um die Bahn aufgestellt wurden). Schöne Ausritte ins Gelände gehörten natürlich auch dazu. Zunächst erfolgten diese mit meinem Vater auf dem Fahrrad und mir auf dem Pony. Später ritt ich mit meinen Cousinen oder Freunden selbständig und ohne einen Führstrick ins Gelände über Stock und Stein.
In den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte ich eines meiner Pferde in Marburg im Reitverein eingestellt, wo ich auch weiteren Reitunterricht nahm. Schöne Ausritte gehörten auch in der Umgebung von Marburg-Wehrda wieder dazu. Auch nahm ich an Dressurprüfungen bei verschiedenen Reitturnieren im Landkreis Marburg-Biedenkopf teil und absolvierte bei meinem Reitverein das bronzene Reitabzeichen, wobei ich eine Dressuraufgabe reiten sowie theoretische Fragen zu Pferdehaltung und -sport beantworten musste.
Nach dem Abschluss meiner Ausbildung zur DV-Kauffrau verließ ich Marburg wieder und zog wieder in mein Elternhaus ein, wo ich meine Pferde einstellen konnte.
Um die Tiere kümmere ich mich weitgehend allein. Ausnahme war früher natürlich die Schulzeit, während deren meine Pferde von meiner Familie betreut wurden.
Da es sich bei meinem Zuhause um ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen handelt, mit Stallgebäude und Scheune, kann ich mein Hobby weitgehend autark ausüben, d. h. es gibt auch einen Reitplatz sowie einen großen Paddock mit entsprechender Umzäunung.
Die tägliche Arbeit im Stall umfasst das Füttern der Pferde morgens und abends, die Pflege sowie das Ausmisten der Pferdeboxen. Bei gutem Wetter bringe ich die Pferde auf den Paddock, wo sie sich den ganzen Tag aufhalten. Dies geschieht, bevor ich zur Arbeit fahre, d. h. natürlich früh raus aus den Federn!
Das Bewegen oder Reiten ist nach meiner beruflichen Tätigkeit am Nachmittag oder am Abend bzw. am Wochenende angesagt. Entweder werden die Pferde longiert bzw. im Freilauf bewegt oder ich Schwinge mich in den Sattel! :-)
Die Besuche des Hufschmieds sowie von Tierärzten manage ich ebenfalls ohne Hilfe. Genau genommen benötige ich nur Hilfe beim jährlichen Einfahren von Heu und Stroh in die Scheune sowie beim Pflegen des Reitplatzes mittels meines kleinen Oldtimer Weinbergtraktors, den ich ja leider nicht fahren darf (die Umzäunung wäre dann doch wohl zu sehr gefährdet!).
Der direkte Umgang mit meinen Pferden seit nunmehr über 50 Jahren bedeutet für mich Lebensglück. Dabei steht mittlerweile die Fürsorge für die Vierbeiner im Vordergrund. Der tägliche Umgang mit den Tieren erfüllt mich mit Freude und ist nebenbei auch entspannend. Das Reiten steht dabei nicht mehr so im Vordergrund wie in meinen jüngeren Jahren. Mich erfüllt das Miteinander mit den Pferden und das Vertrauen, welches sie mir entgegenbringen. Dabei spielt es keine Rolle, dass ich blind bin. Alle Pferde, die ich bis heute betreut habe, stellten sich in kürzester Zeit auf mich ein, z. B. lernen sie relativ schnell, dass ich nicht gezielt an das Stallhalfter greifen kann, da ich ja nicht genau abschätzen kann, wie hoch das Pferd gerade seinen Kopf hält oder wo es aktuell hinschaut. Die Pferde haben immer schnell begriffen, dass sie mit ihren Nüstern meine Hand berühren müssen.
Neben den Pferden gab es auch immer andere Tiere. Die Bandbreite reichte von Kanarienvögeln, Enten und Hühnern über Meerschweinchen und Kaninchen bis zu Katzen und natürlich mehreren Hunden. Aktuell besitze ich zwei ehemalige Straßenhunde aus Spanien.
Ich kann sagen, Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, bedeuten mein Leben, und damit schlage ich den Bogen zum Beginn meines Beitrags:
„Ein Leben ohne Tiere ist möglich, aber sinnlos!“
Bild: Winny, ein dunkler Vollblut-Wallach mit einem hellen Keilstern im Gesicht, schnuppert vorsichtig am Arm von Mirjam Herrmann, während sie ihn bürstet. Beide schauen sich an. Mirjam Herrmann trägt ein blaues, langärmeliges Arbeitshemd mit weißen Längsstreifen und hat ihr hellblondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Foto: privat
J. Hüttich und D. Balzer: Sportunterricht mit Kopf, Herz und Huf an der blista
Von Johanna Hüttich und Daniel Balzer
Der Pferdesport hat an der Carl-Strehl-Schule, dem grundständigen Gymnasium der blista, eine lange Tradition. Bereits Ende der siebziger Jahre entwickelten sich erste Angebote für Schülerinnen und Schüler, den Kontakt zum Partner Pferd zu erleben und reiterlich aktiv zu sein. Seinerzeit zuerst in Kooperation mit einem zugewandten Reitbetrieb, bevor in den achtziger Jahren der Entschluss fiel, das Reitangebot auszuweiten und weiter sehbehindertenpädagogisch zu professionalisieren.
Seither haben sich die Möglichkeiten für die Lernenden sukzessive erweitert und der Pferdesport hat sich zu einem festen Sportangebot etabliert. Die Carl-Strehl-Schule verfügt daher aktuell neben dem Lehrpersonal der typischen Unterrichtsfächer auch über drei vierbeinige Lehrmeister, die den Schülerinnen und Schülern neugierig und aufgeschlossen im Schulalltag gegenübertreten.
Das pädagogische Reitsportangebot verfolgt einen inklusiven Ansatz, der den Schülerinnen und Schülern – ganz gleich, ob mit oder ohne Sehbeeinträchtigung oder reiterliche Vorerfahrungen – vielfältige Lernprozesse mit den vierbeinigen Lernbegleitern ermöglicht und zugleich einen körperlichen und mentalen Ausgleich zu anderen schulischen Anforderungen bietet.
Die Angebote im Reitstall starten im zweiten Halbjahr der fünften Klasse mit dem verbindlichen Sportunterricht am Pferd, bei dem die Kinder bereits in der ersten Stunde die Pferde Paul, Pedro und Henry kennenlernen. Sie entwickeln häufig schnell ein Gefühl der Verbundenheit, indem sie die Pferde im natürlichen Verhalten in der Gruppe beobachten und so die verschiedenen Charaktereigenschaften der Tiere entdecken. Schnell entsteht der Wunsch, mit den imposanten und kräftigen Lebewesen näher in Kontakt zu kommen. Doch wie nimmt man nun Kontakt zu einem Pferd auf? Welche Signale werden benötigt, um gegenseitiges Verständnis aufzubauen? Woran werden Bedürfnisse des vierbeinigen Freundes offenkundig?
Die Kinder lernen zunächst spielerisch, die nonverbalen Signale der Tiere wahrzunehmen und selbst offen auf sie zuzugehen. Dabei spielen insbesondere auch akustische Signale wie Schnauben, Bewegungsgeräusche oder auch Wiehern eine zentrale Rolle.
Besonders beim Führen – später auch beim Reiten – der Pferde spielt die eigene Körperhaltung eine wichtige Rolle. Eine klare Körpersprache des Menschen ist entscheidend für die Kommunikation und bildet die Grundlage für die nachfolgenden Aktivitäten.
Diese Aktivitäten beinhalten Übungen zur Pferdepflege, das erste Aufsteigen, sowie Balance- und Koordinationsaufgaben und verschiedene Spiele. Die Kinder sollen lernen, sich auf dem Pferderücken wohlzufühlen und einen stabilen Grundsitz zu entwickeln. Die Fortschritte, die sich dabei im Verlauf der Unterrichtswochen und -monate beobachten lassen, sind mitunter riesig und die Freude am Umgang mit dem vierbeinigen Partner lässt die Zeit im Stall häufig wie im Fluge vergehen.
Den Abschluss der fünften Klasse an der Carl-Strehl-Schule können die Kinder gemeinsam mit den Pferden auf einem idyllischen Hofgut unweit von Marburg genießen. Hier leben sie vier Tage lang Tür an Tür mit ihren vierbeinigen Freunden, lernen, wie man die Pferde versorgt, vertiefen ihre reiterlichen Fähigkeiten und erleben unvergessliche Aktivitäten wie eine Reiterstaffel, Ausritte oder das Baden mit den Pferden.
Pädagogisch gesehen können die Kinder dabei ihr Selbstvertrauen im Umgang mit den Pferden stärken und Verantwortungsbewusstsein üben. Sie verbessern ihre motorischen Fähigkeiten und erleben ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Denn Aufgaben wie die Versorgung der Pferde oder die Zubereitung des Abendessens werden im Team übernommen, wobei sich die Kinder gegenseitig unterstützen, um alles rechtzeitig fertigzustellen.
Nach Abschluss des Projekts haben die Kinder weiterhin die Möglichkeit, Zeit im schulischen Reitstall zu verbringen, ihre erlernten Fähigkeiten zu festigen und den sicheren Umgang mit den Pferden weiter auszubauen.
Ab der siebten Klasse können interessierte Schülerinnen und Schüler an einer Reit-AG teilnehmen und so den Kontakt zu den Pferden auch in der Mittelstufe aufrechterhalten. In der Oberstufe gibt es mit dem Wahlpflichtsportkurs „Reiten“ sogar die Möglichkeit, Punkte für das Abitur zu sammeln.
Das Reitsportkonzept der Carl-Strehl-Schule verbindet somit über die gesamte Schulzeit in Marburg praxisnahe, tiergestützte Aktivitäten mit dem Lernalltag und ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, ihre motorischen, emotionalen und sozialen Kompetenzen zu stärken. Durch die Verbundenheit mit den Pferden lernen sie, sich realistische Ziele zu setzen, regelmäßig Verantwortung zu übernehmen und Begeisterung zu entwickeln.
Zum Autorenteam
Johanna Hüttich ist Lehrkraft für Sport und Biologie und unterrichtet Reiten an der Carl-Strehl-Schule. Daniel Balzer ist Lehrkraft für Deutsch und Wirtschaftslehre und koordiniert das Reiten als Schulsport an der Carl-Strehl-Schule.
Bild: Drei blista-Schülerinnen mit Pferd im Reitstall: Während ein Mädchen reitet, führt auf einer Seite eine Schülerin das Pferd an der Leine, auf der anderen Seite begleitet eine Schülerin mit Reithelm die Reiterin. Co-Lehrkraft Lea Köhler läuft neben dem Mädchen-Trio mit und hält beide Daumen nach oben. Foto: blista
G. Lütgens: Tiere in meiner Nähe oder: Auch für Ohr und Hand sind Tiere interessant
Von Gisela Lütgens
Interesse an Tieren wecken
Mein Vater, der wie ich in früher Kindheit erblindet ist, kannte viele Tier- und Pflanzenarten; er hatte ein beeindruckendes Gedächtnis und Vorstellungsvermögen. Sein großes Hobby war das Sammeln von Tierstimmen, die er bei Wanderungen in Niedersachsen, bei Reisen durch Deutschland und europäische, auch fernere Länder mit seinem transportablen Tonbandgerät - später mit einem Kassettenrecorder - aufnahm. Manche Stimme ließ sich in Zoos einfangen, andere auf Schallplatten bekommen. Seine Aufnahmen hat er mit Ansagen versehen und systematisch sortiert, was ohne Möglichkeit der Digitalisierung noch mit manuellem Schneiden und Kleben (Cutterbox) verbunden war. Meine Mutter teilte sein Naturinteresse, und wir Kinder wurden bei Spaziergängen oft auf Vogelstimmen aufmerksam gemacht. Besonders prägten sich mir diejenigen ein, die meine Eltern hörbar beglückten.
Zahlreich waren damals (in den 1960-er Jahren) auch noch Heuschrecken zu hören, von denen wir einige Arten an ihren unterschiedlichen Zirp-Geräuschen zu erkennen lernten. Um eine Heuschrecke einer bestimmten Art auf Band aufnehmen zu können, ließ sich mein Vater von meiner flinken Schwester bisweilen eine fangen, die dann in einer mit etwas Luft gefüllten Plastiktüte nach Haus gebracht und in ein Terrarium gesetzt wurde. Nach gelungener Aufnahme wurde sie wieder freigelassen; bis dahin konnten wir sie aber im Wohnzimmer ab und zu zirpen hören!
Wir hatten nacheinander einzelne Wellensittiche, die jeden Tag eine Zeitlang durch die Wohnung fliegen durften. Gefreut habe ich mich immer, wenn einer mal zu mir kam und auf Kopf oder Schulter landete. Einer ist leider auch mal in unser Badewasser gerutscht, hat es aber gut überstanden. Wenige Jahre hatten wir eine (in Asien heimische) Schamadrossel, die uns mit ihrem flötenden Gesang erfreute. Für sie hielten wir in einem Schraubglas Mehlwürmer, mit denen wir sie – einzeln durchs Gitter gereicht – fütterten. Unsere Schildkröte hat leider den Winterschlaf im Keller nicht überlebt; wir haben nicht erfahren, ob oder wie man es hätte verhindern können. Zeitweise hatten wir in einem größeren Vogelkäfig Zebrafinken und andere Exoten. An sich passt solche mit Transport und Freiheitsentziehung verbundene Haltung nicht zu einem Tierfreund; aber damals hat man sich diesbezüglich – wie auch über die Bedingungen in Zoos – offenbar noch kaum Gedanken gemacht, und für uns als Kinder war es schön, Vögel so nah zu erleben, einen Goldhamster, Feldmäuse, eine Schildkröte anfassen zu können. Für wenige Wochen hatten wir ein Meerschweinchen in Pflege, dessen quiekenden Ruf ich gern imitierte, wie später auch die Rufe manch anderer draußen gehörter Tiere.
Wo es möglich war, hat meine Mutter mich an Tiere herangeführt: einen Hund, einen Igel, eine Amsel, die gegen eine Fensterscheibe geflogen war, eine Kröte, einen großen Käfer, eine Nacktschnecke, ... Klar, es war nicht angenehm, den Schleim einer Schnecke auf der Hand zu haben; aber als blinder Mensch gewinnt man schließlich die beste Vorstellung durch direkte Berührung. Die lockere Herangehensweise meiner Mutter, mein Interesse und das Wissen um die seltene Gelegenheit ließen keinen Ekel, auch keine Scheu aufkommen.
In dem Zusammenhang fällt mir ein tierisches Erlebnis aus meiner Berufstätigkeit in der Braille-Druckerei der blista ein: Eines Morgens kam ein Kollege zu uns, der sein Arbeitszimmer nicht betreten mochte, weil dort - wohl über Nacht - eine Maus hereingekommen war. Verwundert über seine Aufregung ging ich mit ihm zu seinem Büro, wo er mich aus sicherer Entfernung zu der Maus dirigierte. Sie lief gar nicht weg, war offenbar geschwächt und ließ sich leicht von mir in der Hand aus dem Haus bringen.
Weitere Gelegenheiten, Tiere anzufassen, ergaben und ergeben sich in Zoos, auf Bauernhöfen oder bei Freunden. Bei Ausstellungen bedarf es manchmal nur einer Frage, ausgestopfte Tiere auch fühlend bestaunen zu dürfen. Schön ist es auch, den Schnabel, die Lippen oder die raue Zunge eines Tieres zu spüren, das einem aus der Hand frisst, wie beispielsweise ein Alpaka, das ich bei einem Ausflug im Rahmen unseres letztjährigen Seminars der Interessengruppe Ruhestand des DVBS streicheln und füttern konnte.
Von meinen Eltern mit den Lautäußerungen von Garten-, Wald-, Meeres- und anderen Vögeln vertraut gemacht, freue ich mich, dass mein Mann – ein aufmerksamer Beobachter – mein Interesse an der Vogelwelt teilt. In Marburg haben wir manchmal an vogelkundig geführten Morgenwanderungen teilgenommen; so konnten wir die Kenntnisse immer wieder auffrischen. Auf unserer Lieblingsinsel Amrum nehmen wir in jedem Urlaub auch an mindestens einer Führung teil, in deren Mittelpunkt die Vogelarten stehen. Dabei geht es vor allem um Verhalten und optische Merkmale der oft nur durchs Fernglas bzw. Spektiv klar erkennbaren Vögel. Informationen zu den Farben des Federkleids prägen sich mir nicht ein - für mich stehen eben Ruf und Gesang im Vordergrund -, aber es ist schön, die Begeisterung der mitgehenden Kinder und Erwachsenen mitzuerleben. Meine Gedanken an die Insel sind mit beglückenden akustischen Erlebnissen verbunden: Ringelgänse, Feldlerchen, Rotschenkel und Große Brachvögel.
Zugänge zur exotischen Tierwelt
Bevor wir 1998 zum ersten Mal meine Verwandten in Namibia besuchten, haben wir eine Vogelstimmensammlung auf 3 Kassetten erworben. Diese Aufnahmen habe ich auf DAT-Kassetten überspielt, um im Urlaub, in dem ich Mikrofonaufnahmen mit meinem DAT-Recorder machen wollte, darauf zugreifen zu können. Mein Mann hat mir die Liste der Vogelnamen von den Beiblättern in eine Word-Datei abgeschrieben, die ich - in Punktschrift ausgedruckt - mitnehmen konnte. Allerdings wurden keine deutschen, sondern nur englische Namen angesagt, und die Liste enthielt neben den nummerierten englischen die Namen in Afrikaans und Latein. Ein Buch zu den Vögeln Südafrikas konnten wir zwar in Namibia erwerben, bekamen die deutschen Namen aber schließlich erst in einer separaten Liste. Diese ließ ich mir nach unserer Rückkehr diktieren, um auch eigenständig darauf zugreifen zu können.
Meine Verwandten sind mit uns durchs Land gefahren: zu einer riesigen Kolonie südafrikanischer Seebären (ihre Rufe klangen wie eine unvorstellbar große Schafherde), in die Namib-Wüste (trockene September-Hitze, kaum Vögel zu hören, aber plötzlich laut die Landung einer Fliege auf meinem Richtmikrofon) und zu Naturschutzgebieten (in der Etoschapfanne darf man das Auto nur in den eingezäunten Unterkünften verlassen). Die Verwandten und mein Mann haben mir Geräusche vermeidend ermöglicht, die Stimmen der von ihnen beobachteten Tiere aufzunehmen oder einfach alle hörbaren Eindrücke auf mich wirken zu lassen. Enttäuschend waren allerdings Situationen, in denen sie beispielsweise begeistert zig Zebras sahen, die Autofenster öffneten und kein einziges zu hören war. Bei einem späteren Besuch waren wir auf einer Straußenfarm, wo ich den Rücken und dünnen Hals eines jungen Strauß' anfassen konnte! In der Nähe der Küstenstadt Swakopmund bin ich mal auf einem geführten Dromedar geritten, das sich angenehm langsam bewegte. Unvergesslich ist mir auch eine Bootsfahrt, bei der ich einen ans Füttern gewöhnten Seelöwen berühren konnte, der sozusagen neben mir Platz genommen hatte!
Durch Vermittlung meiner Verwandten haben wir eine Gästefarm kennengelernt, auf der wir inzwischen mit vieljährigem Abstand dreimal gewesen sind. Es ist immer wieder etwas Besonderes, sichtgeschützt in der Nähe einer Wasserstelle zu sitzen und - sich allenfalls flüsternd unterhaltend - aufmerksam zu lauschen, ob außer ein paar Vögeln eines der sich nähernden Säugetiere oder etwa in der Ferne ein Pavian ruft. Im Gegensatz zu meinem Vater mache ich meine Tonaufnahmen ohne wissenschaftlichen Anspruch, nur zu meiner Freude und Teils beglückenden Erinnerung. Auf der Farm habe ich in so mancher Nacht bei geöffneten Fenstern aufmerksam in die Stille gelauscht; plötzlich jaulte dann mal ein Schakal, rief ein Perlkauz oder ein mir noch unbekannter Vogel. Ein über die Betten gespanntes Netz sorgte dafür, dass uns keine Mücken piesackten.
Für den Besuch bei Verwandten und Freunden im Staat New York haben wir uns 2006 eine entsprechende Vogelstimmensammlung mit englischen Ansagen besorgt, die immerhin auf CDs erhältlich war, aber wie auch die Vogelbücher in den USA bestellt werden musste. Ich hatte inzwischen einen DAISY-Recorder, habe die CDs auf dessen Speicherkarte kopiert und mit ihm unterwegs auch Tonaufnahmen gemacht. Wie in Namibia hatten wir nicht den Anspruch, viele Vogelstimmen lernen zu wollen. Dies wird ja auch dadurch erschwert, dass längst nicht jeder Vogel, den man sieht, in dem Moment auch singt, dass mehrere gleichzeitig singen oder dass ein gehörter Vogel dem suchenden Auge verborgen bleibt. Ohne Experten musste mein Mann einen unbekannten gesehenen Vogel erst anhand des Vogelbuches bestimmen; aber diese Information erleichterte es mir, später zur Bestätigung den evtl. gehörten Gesang zu finden.
Vogelkundliche Exkursionen
Seit 2012 nehmen wir an Reisen mit vogelkundigem Reiseleiter teil. In dem Zusammenhang haben wir auch einen Vogelimitator, den wir aus Fernsehsendungen kannten, persönlich kennengelernt. Bei seinem Wochenendkurs lenkte er die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden in erster Linie aufs Hören, bevor er uns die Stimmen und andere Erkennungsmerkmale der Vögel in der Umgebung unserer Unterkunft nahebrachte. Einmal waren wir mit einem vogelkundigen Reiseleiter in Südfrankreich, sonst aber immer in Deutschland, wo wir zum Beispiel den Spreewald so zu schätzen lernten, dass wir dort im Folgejahr mit Auto und Tandem nochmal allein hingefahren sind und einen schönen Urlaub verbracht haben. Nicht billig, aber sehr lohnend war eine Kahnfahrt ohne Motor durch die schmalen Fließe mit orts- und naturkundigem Kahnführer ohne weitere Fahrgäste! Zu den besonderen Vögeln gehörten dort für mich Pirole.
Im vorigen Jahr hat uns eine Freundin gebeten, bei ihrer Geburtstagsfeier einen kleinen Vortrag über Vögel zu halten. Das habe ich übernommen und die Vogelstimmen dafür zusammengestellt; in Kombination mit den von meinem Mann präsentierten Fotos kam das recht gut an.
Als Rentnerin bin ich 2017 in meine Geburtsstadt Hannover zurückgekommen und wohne mit meinem Mann in der Nähe der Eilenriede, dem großen Stadtwald, durch den wir gern spazieren oder mit dem Tandem fahren. In diesem Jahr hörten wir am ersten März schon eine Singdrossel (sie hat wechselnde Motive, die sie aber jeweils wiederholt), und am vorausgehenden Wochenende zogen hier schon laut rufend Kraniche ostwärts.
Wenn ich einen Pirol höre, denke ich an meinen Vater, der von dessen Gesang unseren Familienpfiff abgeleitet hat. Das Rotkehlchen war der Lieblingsvogel meiner Mutter; meiner ist die Goldammer, aber es gibt viele andere Vögel, über deren Gesang ich mich auch jedes Jahr freue. Leider habe ich manche mir vertraute Vogelarten in den letzten Jahren kaum noch oder gar nicht mehr gehört. Auch Heuschrecken – früher für mich der Inbegriff des Hochsommers – scheint es kaum noch zu geben.
Wir können uns zwar nicht alle Vogelstimmen merken (manche hört man ja auch nur selten), sie aber bei Unsicherheit anhand kommerzieller Aufnahmen finden und verifizieren. Wanderungen mit Gleichgesinnten und Experten bieten viele Gelegenheiten, sich gegenseitig auf gehörte und/oder gesehene Vögel aufmerksam zu machen, falsch Erinnertes klarzustellen und immer wieder etwas dazuzulernen. Ich empfinde mich nach wie vor nicht als Profi, freue mich aber, bei Spaziergängen viele der mich umgebenden Laute den jeweiligen Vogelarten zuordnen und auch mal andere darauf aufmerksam machen zu können.
Im Mai werden wir bei einer von einem Ornithologen geleiteten Reise die Vogelwelt auf Langeoog erleben. Ob dazu auch Große Brachvögel gehören, deren flötenden Gesang ich so gern, in den letzten Jahren auf Amrum aber kaum noch gehört habe?
Zur Autorin
Gisela Lütgens, geb. 1955, war als Internatsschülerin im Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover und in der blista in Marburg. Nach 40-jähriger Berufstätigkeit als Korrektorin in der Braille-Druckerei der blista lebt sie nun wieder in ihrer Geburtsstadt Hannover. Zu ihren Hobbies gehört der Gesang in gemischten Chören, wo ihr die im Klavierunterricht vermittelte Kenntnis der Blindennotenschrift das von Nachbarsänger*innen unabhängige Lernen erleichtert.
Bild: Gisela Lütgens sammelt in einem Dünental auf Spiekeroog Eindrücke des herbstlichen Naturschutzgebiets. Auflaufendes Wasser läuft um ihre Schuhe. Sie ist mit Rucksack und Langstock ausgerüstet, hat die Kapuze ihrer roten Windjacke tief ins Gesicht gezogen und spricht in ihr Aufnahmegerät. Foto: privat
M. Saegbebarth: Unterwegs im Großstadtdschungel - Den Zoo Leipzig mit allen Sinnen erleben
Von Maria Saegebarth
Der Zoo Leipzig ist ein Ort der Entdeckung, der das Erlebnis der Natur auf eine völlig neue Ebene hebt. Hier, mitten im Herzen der Stadt, wird der Besuch zu einer Reise durch die Welt der Tiere, bei der nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren, die Nase und die Hände im Mittelpunkt stehen. Ein Zoo, der für blinde und sehbehinderte Besucherinnen und Besucher genauso viel zu bieten hat wie für diejenigen, die die Welt mit den Augen betrachten können. Der Zoo Leipzig zeigt, wie eine naturnahe und moderne Zooerfahrung in Zeiten von Artenschutz und Naturverständnis aussehen kann.
Ein Zoo für alle Sinne
Der Zoo Leipzig ist ein faszinierendes Zusammenspiel von Natur, Architektur und Tierhaltung. Besonders für blinde und sehbehinderte Besucher ist er ein Ort, an dem die Natur auf außergewöhnliche Weise erlebbar wird. Die modern gestalteten Gehege, die weitläufigen Freiflächen und die geschützten Rückzugsorte der Tiere schaffen eine einzigartige Atmosphäre, in der Geräusche, Gerüche und Berührungen den Besuch zu einem multisensorischen Erlebnis machen.
Tropenerlebniswelt Gondwanaland
Ein besonderes Highlight für alle Sinne ist die Tropenerlebniswelt Gondwanaland, die im Jahr 2011 eröffnet wurde. Sie ist mit einer Fläche von 16.500 Quadratmetern die größte tropische Regenwaldhalle Europas und ein Meisterwerk moderner Zoogestaltung. In der Tropenerlebniswelt Gondwanaland erleben Besucher eine authentische Kulisse aus tropischen Pflanzen, exotischen Tieren und einer feuchtwarmen Luft, die die Haut sanft umhüllt. Hier ist der Geruch von nassem Holz und exotischen Blüten allgegenwärtig. Der Regenwald lebt durch Geräusche: das Zwitschern der Vögel, das Rascheln der Blätter und das leise Plätschern eines Flusses, der sanft die Szenerie begleitet. In diesem künstlich geschaffenen Mikrokosmos fühlt sich jeder Schritt wie eine Reise in die tropische Wildnis an. Ein Besuch in Gondwanaland ist ein lebendiges Naturerlebnis, bei dem man gleichzeitig die wertvolle Arbeit des Zoos im Bereich des Artenschutzes verstehen lernt.
Taktiles Erleben der Tiere
Der Zoo Leipzig versteht sich als Ort des Erlebens mit allen Sinnen. Taktile Elemente an vielen Gehegen laden die Besucher dazu ein, die Tiere auf ihre ganz eigene Weise wahrzunehmen. Taktile und akustische Lernstationen, Reliefkarten der Anlagen oder Skulpturen von Tieren, die man mit den Händen erkunden kann, eröffnen neue Perspektiven. In einigen Bereichen, wie im Streichelgehege, können die Besucher direkt mit Tieren in Kontakt treten. Ziegen, Schafe und andere Tiere lassen sich berühren, ihre weichen Felle und warmen Körper sind ein intensives Erlebnis. Das sanfte Stupsen mit der Nase oder das zarte Schnauben der Tiere schaffen eine Verbindung zwischen Mensch und Tier, die über das bloße Beobachten hinausgeht.
Die Welt der Raubkatzen – Hören, was in der Luft liegt
In der Löwensavanne begegnen die Besucher der Macht und Schönheit der Raubkatzen. Bereits aus der Ferne hört man das markante Brüllen eines Löwen, das den Raum durchdringt. Die Gegenwart der mächtigen Tiere liegt in der Luft, während man sich ihnen an der Sichtscheibe nähert. Hier, an einem der beeindruckendsten Orte des Zoos, wird deutlich, wie der Zoo Leipzig den Tieren nicht nur Lebensräume bietet, sondern auch faszinierende, aber sichere Begegnung mit ihnen ermöglicht.
Akustische Erlebnisse im Pongoland
Im Pongoland, dem Reich der Menschenaffen, erwartet die Besucher eine besonders facettenreiche akustische Erfahrung. Die Stimmen der vier Menschenaffenarten –Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans – sind weithin hörbar. Schimpansen kommunizieren durch kräftige Rufe, während Bonobos oft in hitzige Diskussionen verfallen. Diese Geräuschkulisse ist nicht nur Teil des Zoos, sondern trägt zum Verständnis der Tiere bei. Wer sich Zeit nimmt, kann die komplexen sozialen Interaktionen der Affen beobachten und verstehen – ein Erlebnis, das weit über das bloße Schauen hinausgeht.
Pongoland gehört zu den herausragenden Beispielen für die Architektur des Zoos Leipzig. 2000 eröffnet, bietet die Anlage den Menschenaffen eine naturnahe und großzügige Lebensumgebung. Diese innovative Anlage hat nicht nur ihre Lebensqualität erheblich verbessert, sondern ist auch ein Zentrum für wissenschaftliche Forschung, in dem die soziale Struktur und das Verhalten der Affen untersucht wird. Hier zeigt sich, wie moderne Zoos nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur Forschung und zum Schutz von Tieren beitragen.
Einblicke in den Alltag – Kommentierungen durch die Tierpflegenden
Ein besonderes Highlight für die Besucher des Zoos Leipzig sind die spannenden Kommentierungen durch die Tierpflegenden, die während ihrer täglichen Arbeit Einblicke in das Leben der Tiere und ihre eigenen Aufgaben geben. Diese Fixpunkte bieten nicht nur interessante Informationen über die Tiere, sondern auch über die Arbeit, die hinter den Kulissen des Zoos stattfindet. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger erzählen von den individuellen Bedürfnissen der Tiere, ihrer Ernährung und den speziellen Pflegeanforderungen. Oftmals geben sie auch einen persönlichen Einblick in die Beziehungen, die sie zu ihren Schützlingen aufgebaut haben, und wie diese oft jahrelange Partnerschaften zwischen Mensch und Tier gestalten. Die blinden und sehbehinderten Besucher haben die Möglichkeit, sich durch die akustischen Erklärungen der Tierpfleger auf eine spannende Entdeckungsreise zu begeben, die nicht nur die Tiere selbst, sondern auch die Menschen hinter den Kulissen in den Fokus stellt. Diese Geschichten über das tägliche Leben im Zoo, über Herausforderungen und Erfolge, eröffnen den Besuchern einen tieferen Zugang zu den komplexen Beziehungen zwischen Tierpflegern und Tieren und verdeutlichen, wie wichtig die Arbeit im Artenschutz und die enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier ist.
Ein Zoo im Wandel – Moderne Architektur und Artenschutz
Der Zoo Leipzig ist ein Paradebeispiel für die Philosophie moderner Zoos, die nicht nur als Schauplätze der Unterhaltung, sondern als wichtige Institutionen des Artenschutzes, der Forschung und der Bildung fungieren. Der Zoo hat in den vergangenen 25 Jahren seinen Masterplan „Zoo der Zukunft“ konsequent umgesetzt und sich von einem traditionellen Tiergarten zu einem Zentrum für den Schutz bedrohter Arten und die wissenschaftliche Forschung entwickelt. Im 21. Jahrhundert haben Zoos eine neue Bedeutung gewonnen – sie sind Orte, an denen das Verständnis für die Natur und ihre komplexen Zusammenhänge vertieft wird.
Aktuell wird im Zoo Leipzig das Projekt Feuerland realisiert, eine neue Wasserwelt für Pinguine und Seelöwen. Diese Erweiterung bietet den Besuchern voraussichtlich ab 2026 nicht nur einen spektakulären Einblick in die Unterwasserwelt der südlichen Hemisphäre, sondern unterstützt auch den Artenschutz bedrohter Tiere. Die Architektur von Feuerland ist ein weiteres Beispiel für die innovative Gestaltung von Zoos im 21. Jahrhundert.
Entdeckertouren erleben
Der Zoo Leipzig bietet vielfältige Entdeckertouren an, bei denen die Zoolotsen auf die besonderen Erfordernisse ihrer Gäste eingehen. Geschulte Guides führen durch den Zoo und ermöglichen ein intensives Naturerlebnis, das durch taktile, akustische und olfaktorische Eindrücke bereichert wird. Diese besonderen Führungen sind ein Highlight für alle, die Tiere nicht nur sehen, sondern mit allen Sinnen erleben möchten.
Im Zoo Leipzig wird die Welt der Tiere erlebbar – mit allen Sinnen.
Mehr über den Zoo Leipzig gibt es online unter www.zoo-leipzig.de. Bei Buchungswünschen und Fragen erreichen Sie den Zoo unter Tel.: 0341 5933-385, E-Mail: safaribuero@zoo-leipzig.de.
Zur Autorin
Maria Saegebarth (41) ist Pressereferentin des Zoos Leipzig. Nach ihrem Abitur und einem Volontariat in der Uckermark hat sie als (Sport-)Redakteurin gearbeitet und in Leipzig Sport, Politik und Betriebswirtschaftslehre studiert, bevor sie seit 2010 im Zoo Leipzig arbeitet.
Bild: Kigali und Malu, zwei afrikanische Löwinnen, liegen auf einem Felsen in der Löwenanlage „Makasi Simba“ in der Sonne und schauen den Betrachtenden an. Ihr Freigelände im Leipziger Zoo ist etwa 825 m² groß und ahmt den Lebensraum der Löwen in der afrikanischen Savanne nach. Foto: Zoo Leipzig
Bild: Zwei erwachsene Erdmännchen beobachten mit drei Jungtieren das Außengelände des Zoos Leipzig. Foto: Zoo Leipzig
Dr. E. Hahn: Nur nicht knausern!
Von Dr. Eberhard Hahn
Wenn jemand gesagt bekommt, er habe Augen wie ein Adler, so kann er sich zweifellos geschmeichelt fühlen, obwohl er mit einem richtigen Adler und dessen Sehkraft niemals mithalten kann.
Wer hingegen nur schlecht oder gar nicht sehen kann, wird gelegentlich als Brillenschlange oder Blindschleiche tituliert. Das ist dann sicher abwertend gemeint und damit durchaus unangenehm, aber man kann solche Vergleiche getrost an sich abprallen lassen. Sie sind zwar sprachlich nachvollziehbar, aber in der Sache völlig verfehlt.
Die Brillenschlange, eine Giftnatter aus der Familie der Kobras, trägt zwar ein Brillenornament, aber nicht über den Augen, sondern im Nacken. Schärfer sehen wird sie dadurch wohl kaum können.
Und die Blindschleiche ist keineswegs blind. Sie kann sogar ihre Augen schließen, vielleicht, weil sie dann, wie wir, besser schlafen kann.
Wir, die Hahns, haben unsere eigene Möglichkeit gefunden, mit den Kosenamen Brillenschlange und Blindschleiche umzugehen. Meine Frau ist sehbehindert und ohne Brille ziemlich hilflos. Ich mit meinem geringen Sehrest bin so gut wie blind. Deshalb haben wir uns ein Pärchen Pfeffer- und Salzstreuer in Form von kegelförmig geringelten Schlangen zugelegt. Die eine Schlange trägt eine Brille, die andere eine gelbe Binde mit drei schwarzen Punkten.
Ich habe auch schon gehört, dass sich manche blinde Menschen als Maulwurf bezeichnen. Sie können zwar nicht sehen, finden sich aber in ihrer Welt sehr gut zurecht.
Wenn uns wider Erwarten etwas gelingt, sagen wir vielleicht selbstironisch: „Oh, hätte ich mir gar nicht zugetraut! Ein blindes Huhn findet eben auch mal ein Korn.“ Schön und gut. Aber wenn wir diesen Spruch von jemand anderem gesagt bekommen, kann das ganz schön kränkend wirken. Also bitte erst denken, dann reden — oder es lieber bleiben lassen.
Verblüffend erscheint mir, welche Berühmtheit das harmlose Gesellschaftsspiel „Blinde Kuh“ erlangt hat. Es ist anscheinend, wenn auch in den verschiedensten Varianten, auf dem ganzen Globus bekannt und seit Jahrhunderten beliebt. Ein Spieler muss mit verbundenen Augen irgendeine Aufgabe lösen. Die anderen dürfen sich amüsieren, wie seltsam sich ihr Freund plötzlich anstellt, nur weil er gerade nicht sehen kann.
Oft bekamen die Leute zum Verdecken der Augen Tiermasken aufgesetzt. Sie sollten dann wohl gewisse Dämonen spielen, die es auszutricksen galt. Wenn heutzutage im Kindergarten „Blinde Kuh“ gespielt wird, denkt natürlich niemand mehr an böse Geister.
Aber es ist doch erstaunlich, wofür der Name „Blinde Kuh“ inzwischen herhalten muss, wie man im Internet nachlesen kann. Johann Strauß schrieb eine Operette „Blindekuh“. 1915 kam ein gleichnamiger Stummfilm heraus, und auch die Fernsehserie „Tatort“ hat eine Folge „Blindekuh“ zu verzeichnen. Wenn Sie gerne gut speisen, können Sie in Basel oder in Zürich ein Dunkelrestaurant „Blindekuh“ aufsuchen. Besonders überraschend fand ich schließlich, dass es von 1997 bis 2023 eine Suchmaschine für Kinder namens „Blinde Kuh“ gab.
Warum eigentlich muss das blinde Tier ausgerechnet eine Kuh sein? Kühe haben doch nichts besonders Blindes an sich. Eine plausible Erklärung dafür habe ich nicht gefunden. Anscheinend ist das auch nur im deutschen Sprachraum so. Bei den Spaniern ist es ein Huhn, (Gallina Ciega), in Italien sogar nur eine Fliege (Mosca Cieca).
Das schönste Blinde-Kuh-Spiel hat, wie ich finde, Astrid Lindgren beschrieben: Die ganze Dorfgemeinde von Lönneberga ist nach Weihnachten auf den Hof Katthult zum Fest eingeladen. Die Lehrerin verdonnert die Feiernden zu einem Gesellschaftsspiel. Mit verbundenen Augen muss sich jemand eine Braut oder einen Bräutigam aus der Runde heraussuchen und seine Wahl mit einem Kuss besiegeln. Auch der Lausbub Michel kommt schließlich an die Reihe. Die Mitspieler sitzen im Kreis. Michel wird mit verbundenen Augen in die Mitte geführt. „Ich such mir eine Braut“, sagt er pflichtgemäß und muss sich einige Male um sich selbst drehen, damit er die Orientierung verliert. „Ist es die?“, wird er gefragt, während sein Gesicht auf eine Teilnehmerin zeigt. Mutig sagt er: „Ja!“ Als man ihm die Augenbinde abnimmt, merkt er, dass seine Wahl auf die Pfarrersfrau gefallen ist, die alle unsympathisch finden. Er könnte sich für einen Groschen freikaufen, aber nein, Michel klettert seiner „Braut“ auf den Schoß und küsst sie gleich achtmal. „Nur nicht knausern“, meint er. Der Außenseiterin hat er eine Riesenfreude gemacht, die ganze Runde klatscht Beifall, und Michel bekommt sogar endlich einmal ein Lob von seinem Vater.
Nun denn, mögen wir auch Blindschleichen, Maulwürfe, blinde Hühner oder blinde Kühe sein, aber haben wir nicht trotzdem einiges zu bieten, wofür uns unsere Mitmenschen schätzen? Also: Nur nicht knausern!
Zum Autor
Dr. Eberhard Hahn studierte nach seiner Schulzeit an der blista (Abi-Jahrgang 1962) an der Uni Tübingen Mathematik, wo er anschließend als wissenschaftlicher Angestellter am Zentrum für Datenverarbeitung tätig war. Anfang 2001 ging er in den Ruhestand. Seit 2009 redigiert Dr. Hahn das Informationsmagazin der IG Ruhestand im DVBS. Sein liebstes Hobby ist die klassische Musik.
Bild: Dr. Eberhard Hahn hat braune Augen und weißes Haar. Er trägt Hemd und Pullover in Blautönen und wendet sein Gesicht über der rechten Schulter den Betrachtenden zu. Foto: privat
Bild: Praktisch: Brillenschlange (li) mit hellem Köpfchen und Blindschleiche (re) mit dunklem Köpfchen als blaue Pfeffer- und Salzstreuer. Die Streulöcher sitzen an den erhobenen Hinterköpfen der kegelförmig geringelten Porzellan-Schlangen. Foto: privat
Beruf, Bildung und Wissenschaft
O. Altfeld: Auswärtsspiel: Ein Besuch bei der Association Paul et Liliane Guinot
Von Otfrid Altfeld
Paul Guinot
Paul Guinot war als Zeichner – heute würde man ihn als Designer bezeichnen – in einem Stickereibetrieb in den Vogesen beschäftigt, als er im Jahr 1909 infolge eines Unfalls mit 25 Jahren erblindete.
Offenbar gelang es ihm, diese traumatische Erfahrung rasch zu verarbeiten, und er startete bald eine Ausbildung zum Masseur und Physiotherapeuten. Dabei wurde er rasch mit den Fallstricken der französischen Gesetzgebung konfrontiert, die nicht vorsah, dass Menschen mit einer Behinderung überhaupt qualifiziert ausgebildet werden oder gar arbeiten könnten.
Er wurde zu einem wichtigen Akteur der französischen Selbsthilfe und gründete Initiativen, Vereine und Netzwerke zur Förderung der Eingliederung behinderter Menschen in die Gesellschaft, statt sie dem Fürsorgesystem zu überlassen. Die berufliche Qualifizierung von Menschen mit Behinderung stand dabei an erster Stelle. Guinot gründete die Fédération des Aveugles de France und die Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et des Amblyopes (CFPSAA). Zu den von ihm gegründeten Vereinen gehört auch die in 1928 ins Leben gerufene Association Paul Guinot, die sich zum zentralen Ziel gesetzt hat, die Idee der Qualifizierung durch Angebote von beruflichen Ausbildungen für Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung umzusetzen.
Association Paul et Liliane Guinot
Zentraler Ort dieser Angebote ist heute das „Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle (ESRP) Paul et Liliane Guinot“ in Villejuif südlich von Paris, das im Jahr 1984, 15 Jahre nach Guinots Tod, eingeweiht wurde. Hier werden drei Ausbildungen in verschiedenen Branchen angeboten: Masseur-Kinésitherapeute (Masseur*in und Physiotherapeut*in), Conseiller Relation Client à Distance (Customer Care Agent) und Développeur Web et Web Mobile (Entwickler*in für Web- und mobile Applikationen). Alle drei Ausbildungen werden mit staatlich anerkannten Zertifikaten abgeschlossen.
Die Association ist eine Non Profit Organisation, deren Angebote in erster Linie von der Agence régionale de santé ARS Ile de France des französischen Gesundheitsministeriums (Ministère de la Santé et de la Prévention) gefördert werden. Der Zugang zu den Angeboten erfolgt über das regionale MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Die Förderung folgt der Teilnehmendenzahl, so dass die Association Paul et Liliane Guinot das mit der Realisierung der Angebote verbundene wirtschaftliche Risiko selbst zu tragen hat.
Kontakt und Kooperation
Seit 2023 bestehen informelle Kontakte zwischen dem Zentrum für berufliche Bildung (ZBB) der blista und der Association Paul et Liliane Guinot, um sich über die Bedingungen der Inklusion am Arbeitsmarkt in beiden Ländern und über Ausbildungskonzepte der Organisationen auszutauschen.
Dabei wurde rasch klar, dass die kaufmännischen und informationstechnischen Angebote der Association im binationalen Vergleich konzeptionell eher den deutschen Umschulungen entsprechen. Die Ausbildungsdauer beträgt zwei Jahre, der Fokus der Kompetenzvermittlung liegt daher in erster Linie auf fachlichen Inhalten. Die Vorbereitung auf die außerfachlichen Anforderungen und die Entwicklung von personalen und sozialen Kompetenzen treten wegen der beschränkten Ausbildungsdauer etwas in den Hintergrund, wenn sie – wie im Fall der Customer Care Agents – nicht ohnehin zum fachlichen Curriculum zählen.
Bewerber*innen ohne baccalauréat (vergleichbar dem deutschen Abitur) nehmen an einem optionalen zusätzlichen Vorbereitungsjahr teil, der classe préparatoire. Die classe préparatoire ermöglicht den Erwerb eines dem französischen baccalauréat gleichgestellten Bildungsabschlusses, so dass gewährleistet ist, dass die Teilnehmenden an den Ausbildungen auf miteinander vergleichbaren Bildungsniveaus aufbauen können. Dies ist insbesondere auch dann wertvoll, wenn die Teilnehmenden erwägen, nach dem Abschluss der Ausbildung einen Bachelor oder Master Degree zu erwerben.
Die Ausbildung Masseur*in bzw. Physiotherapeut*in mit Diplôme d’État (staatlich geprüft) dauert fünf Jahre, hier wird im Wissen um die hohen Anforderungen des Berufsbildes an die soziale Kompetenz neben den fachlichen auch personalen und sozialen Kompetenzen ein großer Entwicklungsraum gegeben. Die Association Paul et Liliane Guinot fungiert als Institut de Formation en Masso-Kinésitherapeutique (IFMK). Sie gehört damit zu den über ganz Frankreich verteilten Organisationen, die Ausbildungen für Physiotherapeut*innen mit staatlichem Diplom anbieten, von denen sie sich lediglich durch ihre Spezialisierung auf Teilnehmende mit Blindheit oder Sehbehinderung unterscheidet.
Wie in Deutschland wird auch in Frankreich aktuell eine Akademisierung des Berufsbilds des/der Physiotherapeut*in intensiv und ebenso kontrovers diskutiert. Die Association Guinot bereitet sich auf den zu erwartenden Transformationsprozess vor, indem sie die Kontakte zur Université Paris Saclay intensiviert, um hinsichtlich der zukünftig möglicherweise einzurichtenden Bachelor/Master-Studiengänge für Kinésithérapie eine Kooperation zu vereinbaren.
Arbeitsmarkt
Die Anforderungen des französischen IT-Arbeitsmarktes unterscheiden sich recht deutlich von der aus Deutschland bekannten Situation. Unternehmen in Frankreich setzen insbesondere für qualifizierte Beschäftigungen in der IT sehr häufig einen akademischen Abschluss voraus. Dies führt dazu, dass die Absolvent*innen der Ausbildung zum Web Developer trotz intensiven Bewerbungstrainings aktuell nur geringe Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, obwohl auch in Frankreich ein nicht unerheblicher Fachkräftemangel im Bereich der IT herrscht. In Deutschland dagegen werden von IT-Arbeitgebern – mit Ausnahme des öffentlichen Dienstes – Ausbildungen und Bachelorabschlüsse häufig gleichgestellt. Die Unternehmen schreiben Stellen stärker als Funktionen aus, Qualifikationen werden in den Anforderungen formuliert. Von dieser größeren Offenheit der Arbeitgeber profitieren die Absolvent*innen des ZBB in hohem Maße: vier von fünf Absolvent*innen der Ausbildungen der Fachinformatiker*innen hatten im Durchschnitt der letzten 25 Jahre innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausbildungsende einen Job.
Ein Grund für diese sehr unterschiedlichen Bedingungen auf den Arbeitsmärkten liegt sicherlich auch im Qualifizierungsniveau des in Frankreich staatlich anerkannten Web Developers. Die erworbenen fachlichen Kompetenzen sind deutlich auf den Bereich Web Development fokussiert und entsprechen häufig nicht den umfassenderen Anforderungen einer Vielzahl der Arbeitgeber.
Die Association Paul Guinot reagiert nun auf die beobachteten Bedarfe des IT-Arbeitsmarktes, indem sie seit einigen Jahren eine intensive Kooperation mit dem Unternehmen Capgemini unterhält. Capgemini gehört zu den großen europäischen IT-Dienstleistern mit Angeboten im Cloud Computing, in der IT Security und der Unternehmensdigitalisierung und akquiriert über das regelmäßige Angebot von Praktika neue Mitarbeitende unter den Auszubildenden der Association Paul Guinot. Grundlage für diese Kooperation ist die vor einigen Jahren implementierte starke Corporate Identity mit einem klaren unternehmerischen Bekenntnis zur Diversität und Inklusion.
Innerhalb der Association Paul et Liliane Guinot wird zudem aktuell auch für die Ausbildung der Web Developer eine Kooperation mit der Université Paris Saclay diskutiert. Die Universität zeigt sich wie bei der Kooperation im Bereich der Kinésithérapie offen, so dass auch hier in Zukunft mit einer Akademisierung der Ausbildung zu rechnen sein dürfte. Ob Ausbildungsleistungen für das anschließende Studium anerkannt werden und die Semesterzahl dadurch verkürzt wird, ist noch nicht absehbar. Die französischen Universitäten genießen wie die deutschen Hochschulen eine weitgehende Autonomie und entscheiden über die Anerkennung von Vorleistungen.
Problematisch erweist sich bei den Absolvent*innen der Ausbildung zum Customer Care Agent, dass die bei den potentiellen Arbeitgebern eingesetzten digitalen Kommunikationssysteme häufig nicht barrierefrei sind. Zugleich sind die Arbeitgeber nicht selbst die Betreiber dieser Systeme, sondern nutzen die von den Partnern bereitgestellten Customer Relationship Management Systeme. Damit haben sie selbst keinen Einfluss auf die digitalen Arbeitsbedingungen. Für die Absolvent*innen der Ausbildung zum Customer Care Agent sind daher – und da unterscheidet sich die Situation in Frankreich nicht von der aus Deutschland bekannten – in erster Linie auf Beschäftigungen bei öffentlichen Arbeitgebern angewiesen, die auch in Frankreich eine stärkere Verpflichtung zur Schaffung adäquater Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende mit Behinderung haben als private Unternehmen.
Sehr offen präsentiert sich aktuell dagegen der französische Arbeitsmarkt für Absolvent*innen der Ausbildung zum/zur Masseur*in bzw. Physiotherapeut*in. Die Absolvent*innen erhalten häufig bereits im Verlauf der Praktikumsphase während der Ausbildung Angebote für eine spätere Beschäftigung. Die Quote der vermittelten Teilnehmenden liegt seit Jahren bei nahezu 100%, obwohl angesichts des aktuellen Transformationsprozesses in Richtung Akademisierung noch weitgehende Unsicherheit hinsichtlich der von den Arbeitgebern gewünschten Abschlüsse und der zukünftigen Regelung der Berufszulassungen herrscht.
Ausblick
Das ZBB der blista und die Association Paul et Liliane Guinot haben für die Zukunft eine engere Kooperation vereinbart. Für Auszubildende beider Organisationen soll regelmäßig die Gelegenheit zum fachlichen und kulturellen Austausch geboten werden.
Es ist denkbar, dass – ausreichende Englischkenntnisse der Teilnehmenden vorausgesetzt – jeweils ein berufsfachlicher Ausbildungsabschnitt im Umfang von maximal drei Wochen in der jeweils anderen Organisation durchgeführt wird. Damit sollen interkulturelles und fachliches Lernen in die Ausbildungen beider Organisationen integriert werden, um die Bedeutung internationaler Kontakte und Kooperation und nicht zuletzt die kulturelle Bedeutung Europas für uns als private und professionelle Akteur*innen zu betonen.
Bild: Blick auf den Eiffelturm, dessen obere Hälfte im grauen Winternebel versinkt. Foto: privat
Recht
U. Boysen: Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ante Portas (Teil 2)
Von Uwe Boysen
In diesem zweiten Teil meines Beitrages zum am 28. Juni 2025 in Kraft tretenden Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) wird es in erster Linie darum gehen, welche Mechanismen es nach dem Gesetz gibt, um Barrierefreiheit zu gewährleisten oder jedenfalls voranzubringen.
Marktüberwachung bei Produkten und Dienstleistungen
Zentrale Bedeutung für das Gelingen des BFSG hat die sog. Marktüberwachung, die in §§ 20-31 BFSG geregelt ist. Dass eine Marktüberwachung im Hinblick auf Barrierefreiheit Neuland ist, wird hier indirekt eingeräumt(1): Die Länder sind verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre Marktüberwachungsbehörden ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen können(2), und sie müssen ihnen dazu die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen(3).Weiter müssen die Länder eine effiziente Zusammenarbeit und einen wirksamen Informationsaustausch ihrer Marktüberwachungsbehörden sowohl untereinander als auch mit den Marktüberwachungsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sicherstellen.(4) Schließlich wird von den Ländern verlangt, eine Marktüberwachungsstrategie für Produkte zu erstellen.(5) Eine entsprechende Verpflichtung für Dienstleistungen sieht das BFSG nicht vor.
Was haben die Marktüberwachungsbehörden nun im Einzelnen zu tun? Sie müssen u.a. prüfen, ob die geltenden Barrierefreiheitsanforderungen eingehalten wurden. Verbraucher können beantragen, Informationen, die den Marktüberwachungsbehörden vorliegen, in einem barrierefreien Format zu erhalten.(6) Warum hierzu ein Antrag erforderlich sein soll und die Informationen nicht sowieso von den Marktüberwachungsbehörden barrierefrei zu veröffentlichen sind, ist nicht ersichtlich. Denn diese Behörden fallen ohnehin, was ihre Internetseiten und mobilen Anwendungen angeht, unter die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2016/2102 über die Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen sowie unter die Umsetzungsregelungen in BGG und den Landesgleichstellungsgesetzen. Vorzuziehen gewesen wäre daher eine allgemeine Veröffentlichungspflicht in einem barrierefreien Format.
Die für die Marktüberwachung von Dienstleistungen geschaffenen Vorschriften sind wesentlich weniger umfangreich.(7) Grund ist, dass es für Dienstleistungen bisher kein anerkanntes Verfahren zur Überprüfung der Barrierefreiheit und der Konformität gibt, sondern dieses erst noch zu entwickeln ist. Davon geht jedenfalls der European Accessibility Act (EAA) aus. Denn sein Art. 23 Abs. 1 bestimmt, dass die Mitgliedstaaten regelmäßig geeignete Verfahren entwickeln, implementieren und aktualisieren müssen, um zu überprüfen, ob die Dienstleistungen mit den Anforderungen dieser Richtlinie – einschließlich der Beurteilung (von ausnahmsweisen Abweichungen abgesehen) – übereinstimmen. Das BFSG meint offenbar, dass eine solche Überprüfungsstrategie bereits existiert. Denn die Marktüberwachungsbehörde überprüft eine Dienstleistung auch ohne konkreten Anlass stichprobenartig darauf, ob und inwiefern die Dienstleistung den Barrierefreiheitsanforderungen der nach § 3 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung genügt.(8) Bei Webseiten oder mobilen Anwendungen zieht sie die Vorgaben der Anlage 1 zum BFSG heran.(9)
Rechtsdurchsetzung und Bußgeldvorschriften
Recht ist nur gut, wenn es sich auch durchsetzen lässt. Das BFSG verpflichtet die Marktüberwachungsbehörden daher, gegen Wirtschaftsakteure, die sich nicht an die Bestimmungen zur Barrierefreiheit halten, ein Verwaltungsverfahren einzuleiten. Dies geschieht auch, wenn Verbraucher das beantragen, etwa weil sie das fragliche Produkt oder die Dienstleistung nicht oder nur in eingeschränkter Weise nutzen können.(10) Dabei können Verbraucher auch einen Verband, der nach § 15 Abs. 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes anerkannt ist, oder eine qualifizierte Einrichtung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Unterlassungsklagengesetz einschalten, die in ihrem Namen und an ihrer Stelle den entsprechenden Antrag stellen.(11)
Verbände und qualifizierte Einrichtungen können solche Anträge auch selbstständig stellen, wenn der Verstoß ihren jeweiligen satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt(12), was im Antrag darzulegen ist(13). Wichtig ist, dass eine Verletzung eigener Rechte des Verbandes oder der qualifizierten Stelle hierfür nicht vorliegen muss.(14) Gleiches gilt für die Barrierefreiheit von Bescheiden und für leichte Sprache(15) in Verwaltungsverfahren(16).
Geben die Überwachungsbehörden entsprechenden Anträgen nicht statt, können Verbraucher konsequenterweise mit der weiteren Rechtsdurchsetzung gegen die Marktüberwachungsbehörde wiederum die o. g. Verbände und Einrichtungen beauftragen(17), die auch selbst nach § 33 Abs. 2 tätig werden können. Verbraucher haben unter den o. g. Voraussetzungen auch die Möglichkeit, die Schlichtungsstelle des Bundes gem. § 16 BGG einzuschalten.(18) Entsprechendes gilt für die erwähnten Verbände und Einrichtungen.(19) Für das Verfahren gelten die dazu erlassenen Vorschriften des BGG.
Um den Verpflichtungen aus dem BFSG den nötigen „Biss“ zu geben, enthält § 37 Abs. 1 Nrn. 1-10 eine Aufzählung von Ordnungswidrigkeiten, die zu Bußgeldern führen können, teilweise Bußgelder bis zu 100.000 Euro.(20)
Übergangsvorschriften
Zu sehr viel Kritik haben die extrem langen Übergangsvorschriften nach Art. 32 EAA bzw. § 38 geführt. Nicht nur treten die meisten Vorschriften erst am 28. Juni 2025 in Kraft, während der EAA schon aus 2019 und das BFSG aus 2021 stammt, sondern es gilt eine noch längere Frist für Dienstleistungserbringer. Sie können ihre Dienstleistungen bis 27. Juni 2030 weiterhin so anbieten, wie sie dies bereits vor dem 28. Juni 2025 für diese oder ähnliche Dienstleistungen rechtmäßig getan haben.(21) Die dazu vor dem 28. Juni 2025 geschlossenen Verträge bleiben bis Vertragsende unverändert in Kraft(22), jedoch nicht länger als bis zum 27. Juni 2030. Eine noch krassere Frist enthält § 38 Abs. 2. Danach dürfen Selbstbedienungsterminals, die vor dem 28. Juni 2025 eingesetzt wurden, bis zum Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer, aber nicht länger als fünfzehn Jahre nach ihrer Ingebrauchnahme, weiter eingesetzt werden. Im schlimmsten Fall bedeutet das eine Frist bis sage und schreibe 2040! Die allermeisten Abgeordneten, die dieses Gesetz im Mai 2021 beschlossen haben, dürften dem Bundestag dann nicht mehr angehören.
Kritik und Schlussbemerkung
Die Herstellung von Barrierefreiheit auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet, d. h. in allen gesellschaftlichen Bereichen, ist seit Langem eine Forderung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Verbände. Auch die Politik hebt die Notwendigkeit, Verhältnisse zu schaffen, in denen Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt leben können, immer wieder hervor. Bislang gab es dazu weitgehend nur Vorschriften, die sich an staatliche Stellen richteten. Umso wichtiger war es, Anforderungen an Barrierefreiheit nunmehr auch auf private Wirtschaftsakteure auszudehnen und Menschen mit Behinderungen dadurch mehr Lebenschancen zu eröffnen.
Leider bleibt das BFSG hinter diesen Erwartungen zurück. Durch eine krampfhafte 1:1-Umsetzung des EAA in deutsches Recht wird eine effektive Rechtsdurchsetzung weitgehend erschwert, obwohl es nach dem EAA hier – nicht genutzte - Spielräume für den nationalen Gesetzgeber gegeben hätte. Die behördliche Überwachung, ob die privaten Wirtschaftsakteure sich an die Vorgaben zur Barrierefreiheit halten, schafft bürokratische Hindernisse, abgesehen von der Frage, ob die Mitarbeiter*innen dieser neuen Behörden über den erforderlichen Sachverstand verfügen werden. Problematisch ist außerdem, dass es im Gesetzgebungsverfahren nicht gelang, dazu eine Bundesregelung zu treffen und es eigentlich somit 16 Länderbehörden geben muss. Hier hatten die Länder – vielleicht notgedrungen – aber inzwischen ein Einsehen und wollen mittels Staatsvertrag eine einzige zuständige Behörde, wohl in Sachsen-Anhalt, schaffen.
Wenn EAA und BFSG nach ihrer Umsetzung ab Ende Juni 2025 einen Großteil ihrer Wirkungen entfalten, werden sie die Zugänglichkeit der vom Geltungsbereich erfassten Produkte und Dienstleistungen für behinderte Menschen voraussichtlich verbessern. Doch bleiben andere von ihnen nicht erfasste Produkte, Dienstleistungen und Lebensbereiche unberücksichtigt. Dies gilt beispielsweise für den Zugang zu Gesundheitsdiensten sowie für die Bedienbarkeit von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik.
Der Erfolg von EAA und BFSG wird dabei auch davon abhängen, ob und inwieweit es gelingt, die Einhaltung der Pflichten zur Schaffung von Barrierefreiheit bei Herstellern, Importeuren, Händlern und Dienstleistungserbringern durchzusetzen. Ohne eine schon angesprochene wirksame Marktüberwachung wird das nicht möglich sein. Sie wird es aber in effizienter Weise nur mit einer substanziellen - auch fiskalischen - Anstrengung geben.
Insgesamt wird mit dem BFSG zum wiederholten Mal die Chance vertan, gesetzlich zu deutlichen Verbesserungen der gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe behinderter Menschen beizutragen, wie es Leitmotiv der UN-BRK ist. Die Hoffnung, dass an dem Entwurf des BFSG im Gesetzgebungsverfahren noch weitere positive Änderungen erzielt werden könnten, hat sich leider nicht erfüllt, ebenso wenig die im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP angekündigte Verbesserung der Regelungen des BFSG. Dennoch werden sich die Verbände von Menschen mit Beeinträchtigungen darum bemühen, die zweifellos gegebenen Chancen des Gesetzes zu nutzen, damit Standards zur gleichberechtigten Teilhabe unseres Personenkreises auch in der Privatwirtschaft mehr beachtet werden als bisher.
Anmerkungen
(1) Soweit keine Gesetzesangabe erfolgt, handelt es sich um Vorschriften des BFSG. Siehe § 20 Abs. 1 und 2
(2) § 20 Abs. 1 Satz 1
(3) § 20 Abs. 1 Satz 2
(4) § 20 Abs. 1 Satz 3
(5) § 20 Abs. 2 Satz 1
(6) § 21 Abs. 4 und § 28 Abs. 4
(7) §§ 28-31
(8) § 28 Abs. 2 Satz 1
(9) § 28 Abs. 2 Satz 2
(10) § 32 Abs. 1 Satz 1
(11) § 32 Abs. 1 Satz 2
(12) § 32 Abs. 2 Satz 1
(13) § 32 Abs. 2 Satz 2
(14) § 32 Abs. 2 Satz 3
(15) §§ 10, 11 BGG
(16) § 32 Abs. 5
(17) gem. § 33 Abs. 1
(18) § 34 Abs. 1 Satz 1
(19) § 34 Abs. 3.
(20) Einzelheiten in § 37 Abs. 2
(21) § 38 Abs. 1 Satz 1 bis 27
(22) § 38 Abs. 1 Satz 2
Dr. M. Richter, A. Fischer: "Hürden und Hinternisse": Weitere Neuigkeiten aus der Bewilligungspraxis in Sachen Arbeitsassistenz
Von Dr. Michael Richter und Antonia Fischer
Mein letzter Artikel aus horus 4/2024 endete mit dem Fazit: „Die Welt könnte so einfach sein …“. In diesem Sinne möchte ich von zwei weiteren Fallkonstellationen berichten, in denen es immer wieder zu Problemen kommt, und die vielleicht Einblicke in die nötigen Argumente für erfolgreiche Anträge bieten. Beide Fälle sind vor dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zu betrachten, dass eine chancengleiche Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben durch Arbeitsassistenz zu gewährleisten ist (vgl. BVerwG vom 23.01.2018, Az.: BVerwG 5 C 9.16). In einem Fall konnten wir erstinstanzlich vor dem VG leider noch kein positives Urteil erwirken, sind aber in Berufung gegangen. Im zweiten Fall haben wir ein tolles und sehr instruktives Urteil im Sinne der Klägerin bekommen.
Zu den Fällen im Einzelnen:
Fall 1 „Erwerbstätigkeit oder Hobby?“
(nicht rechtskräftiges Urteil des VG Schleswig; Az.: 3 LA 67/24)
Ein Mitglied des DVBS, über 70 Jahre alt, jahrzehntelang erfolgreicher Geschäftsmann, Anwalt und Co-Autor erfolgreicher Publikationen und Bestseller, beantragt Arbeitsassistenz, um sein lange geplantes „Lebenswerk“ zu erstellen. Erwartungsgemäß lehnte das zuständige Inklusionsamt in diesem Fall die Gewährung von Arbeitsassistenz ab und begründete seine Entscheidung mit der ungewissen Aussicht auf den Erfolg dieses Werkes. Es bestritt im Wesentlichen die Erfolgsaussichten in wirtschaftlicher Hinsicht und machte geltend, dass das Vorhaben nicht geeignet sei, die Bestreitung des Lebensunterhalts zu sichern.
Das vorliegende Kernproblem, ob es sich um eine Erwerbstätigkeit oder um eine bloße „Liebhaberei“ handelt, tritt häufiger auf, insbesondere, wenn sich der Ertrag einer geplanten Aktivität erst in der Zukunft realisieren lässt. Selbstverständlich sind Förderungen des Inklusionsamtes nicht für die Unterstützung bei jeglichen Projekten von Menschen mit einer Behinderung vorgesehen, sondern es muss sich generell um eine Erwerbstätigkeit handeln, die eine zumindest realistische Aussicht auf einen lebensunterhaltsichernden Ertrag erwarten lässt.
Konkret stellt sich in der jetzt anhängigen Berufung folgende Frage (die bisher auch noch nicht von Oberverwaltungsgerichten oder gar dem Bundesverwaltungsgericht entschieden wurde): „Ist im Rahmen der Arbeitsassistenzgewährung nach § 185 Absatz 5 SGB IX noch eine neue, selbstständige Tätigkeit eines schwerbehinderten Menschen auch bei erstmaliger Aufnahme nach Vollendung des Regelrenteneintrittsalters förderbar?“ Wenn diese Frage positiv beantwortet wird, stellt sich die weitere Frage, welche konkreten Anforderungen erfüllt werden müssen, um darzulegen, dass ein wirtschaftlicher Erfolg mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eintreten wird.
Angesichts einer zunehmend alternden Bevölkerung in Deutschland und gesellschaftspolitischer Tendenzen, Erwerbstätigkeit auch nach dem Erreichen des Renteneintrittsalters zu ermöglichen (vgl. Rentenflexibilisierungsgesetz), dürfte die Frage der Inanspruchnahme von Arbeitsassistenzleistungen für schwerbehinderte Menschen im Rentenalter von grundsätzlicher und zunehmender Bedeutung sein. Denn nicht zuletzt dieser Personenkreis ist besonders häufig von „gebrochenen“ oder zumindest „unterbrochenen“ Erwerbsbiografien betroffen, z.B. durch überproportional lange Zeiten der Arbeitslosigkeit, längere Zeiten der Rehabilitation im Rahmen eines Behinderungserwerbs etc.
Für eine positive Entscheidung könnten im vorliegenden konkreten Fall die bereits sehr weitgeschrittene Planung des Projektes und die unbestreitbaren Qualifikationen und erzielten Erfolge des Klägers sprechen. Gegen eine positive Entscheidung könnten eventuell sein Alter und die Angst der öffentlichen Hand, in ähnlichen Fällen das unbestreitbare Risiko der zweckverfehlenden Mittelverwendung zu tragen, sprechen. Wir werden weiter berichten!
Fall 2 „Assistenz und Elternzeit statt Doppelbelastung“;
(VG Mainz vom 10.10.2024; Az.: 1 K 140/24.Mz)
Eine blinde Mutter in Elternzeit beantragte Arbeitsassistenz für eine Wiedereingliederungsphase. Problem: Anstatt der arbeitsvertraglich grundsätzlich geschuldeten 20 Arbeitsstunden pro Woche sollte in dieser Phase die Arbeitszeit nur 10 Stunden betragen. Das Inklusionsamt verwies auf den Umstand, dass es sich bei diesem geplanten Stundenumfang nicht um eine Erwerbstätigkeit handeln könne, und lehnte den Antrag ab.
Das VG Mainz sprach einen Anspruch zu und begründete u.a. wie folgt:
„Es ist insbesondere zur Erreichung des Zwecks, dass sich schwerbehinderte Menschen im Wettbewerb mit nichtbehinderten Arbeitnehmern behaupten können, unerlässlich, auch für die Fälle einer elternzeitbedingten Arbeitszeitreduzierung den Anspruch auf Kostenübernahme für eine Arbeitsassistenz zu behalten. Ansonsten könnte aufgrund der lediglich temporär geringeren Arbeitszeit die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten und damit auch der (absehbare) Wiedereinstieg in eine Tätigkeit im Umfang über dem Schwellenwert des § 185 Abs. 2 Satz 3 SGB IX gefährdet sein.
(…) vielmehr soll dem gesetzgeberisch verfolgten Ziel der Verbesserung der Chancengleichheit schwerbehinderter Menschen im Arbeits- und Berufsleben während der gesamten Zeitdauer der Erwerbstätigkeit Rechnung getragen werden und die Norm mithin auch beruflich bereits etablierte Personen schützen (…).
(…) ist hier von einer hinreichenden Resterwerbsfähigkeit auszugehen, da das Arbeitsverhältnis lediglich im begrenzten Umfang ruht und nach der Elternzeit im vollen vertraglichen Umfang wieder auflebt. (…)
Mithin muss es dem schwerbehinderten Beschäftigten entsprechend dem gesetzgeberischen Ziel der Verbesserung seiner Chancengleichheit im Arbeits- und Berufsleben im Vergleich mit nichtbehinderten Menschen (vgl. BVerwG, Urteil vom 12. Januar 2022 – 5 C 2/21 –, juris, Rn. 20; Urteil vom 23. Januar 2018 – 5 C 9/16 –, juris, Rn. 17) überlassen bleiben, das ihm – gleichermaßen wie auch nicht schwerbehinderten Menschen – zustehende Wahlrecht, während ihrer Elternzeit mit abgesenktem Stundenumfang berufstätig zu sein, ausüben zu können. Dies beinhaltet die Entscheidung, flexibel eine Teilzeittätigkeit während der Elternzeit mit notwendiger Arbeitsassistenz aufnehmen zu können, etwa um – auch im Vergleich zu einem nichtbehinderten Beschäftigten – den Anschluss im jeweiligen Berufsfeld nicht zu verlieren und einen ggf. schrittweisen Wiedereinstieg in die berufliche Tätigkeit vollziehen zu können bzw. von vornherein nicht vollständig aussetzen zu müssen. (…) Daher muss der Anspruch auf Kostenübernahme für eine Arbeitsassistenz während der Elternzeit bestehen bleiben, auch wenn dadurch zeitweise die tatsächliche Wochenarbeitszeit unter 15 Stunden liegt. Ansonsten käme es zu einer „doppelten“ Diskriminierung der Klägerin – einerseits als Elternteil, andererseits als schwerbehinderte Person.“
Die Fälle zeigen, dass „Chancengleichheit im Arbeitsleben“ möglich ist, aber auch welche Hindernisse im Einzelfall der Umsetzung entgegenstehen können.
Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein und es Bedarf der Beharrlichkeit. Im Ergebnis hilft aber jedes Urteil, die von den Inklusionsämtern oft zu hohen Hürden zu beseitigen oder zumindest wichtige Klarstellungen zu erreichen und verbindliche Regelungen gerichtlich entwickeln zu lassen.
Noch 200 Jahre Brailleschrift?
A. Dörrbecker: Anwendung und Verwendung der Brailleschrift in der Breite und Tiefe erhalten
Von Alexander Dörrbecker
Im 200. Jahr der Erfindung der Blindenschrift durch Louis Braille sind wir aufgerufen, uns weiterhin nachdrücklich für diese Schrift einzusetzen und öffentlichkeitswirksam für den Erhalt und die weitere Verbreitung insbesondere in der schulischen Ausbildung einzutreten.
Worum geht es heute
Worum muss es uns heute gehen, nachdem sich die Brailleschrift spätestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Verwendung unter Blinden durchgesetzt hat?
Ich nehme wahr, dass die Brailleschrift unter Schülern und jungen Leuten, die hochgradig sehbehindert oder blind sind, in der Verwendungsbreite abnimmt. Eine rudimentäre Kenntnis der Vollschrift für gelegentliche Braillezeilennutzung wird für ausreichend gehalten. Das schöpft die Hilfestellung, die uns diese Schrift bieten kann, bei weitem nicht aus.
Hier müssen wir entgegenwirken, um den jungen Menschen zu zeigen, welchen Nutzen die Brailleschrift für Nicht-Sehende hat und was sie zur Inklusion beitragen kann. Viele nehmen diesen Nutzen nicht wahr, weil sie ihn nicht kennen und niemand da ist, der es ihnen vermittelt.
Wir alle kennen es und erleben es zur Zeit. Blindenschriftbibliotheken schließen, Zeitschriften werden eingestellt, weil die Leserzahlen drastisch sinken. Wie auch bei Sehenden nimmt auch bei Blinden und Sehbehinderten die Nutzung anderer Medien wie sozialen Medien und Büchern über Tablets und Smartphones zu. Anders als bei Sehenden: Das Vorlesenlassen löst das Selbstlesen ab.
Probleme der Braillenutzung im Alltag
Blindenschriftbücher und Material ist natürlich nicht überall verfügbar und Blindenschriftbücher nehmen mehr Platz weg und sind schwerer zu transportieren. Auch ist die Herstellung aufwendiger und teurer. Braillezeilen wiederum, die das elektronische Lesen ermöglichen, sind nach wie vor kostspielig und technisch in ihren Anwendungsmöglichkeiten nicht mit dem allgemeinen Fortschritt der modernen Elektronik der letzten Jahre mitgegangen. Sie sind zu groß und die Mechanik ist wartungsintensiv. Braillezeilen und Notizgeräte von vor 20 Jahren konnten nicht weniger als die heutigen Modelle. Hersteller gibt es weltweit weniger als damals. Vom Ganzseitendisplay wird seit Jahrzehnten gesprochen und damit experimentiert. Aber brauchbare Geräte für den Endkonsumenten sind leider nicht auf den Markt gekommen. Die Kosten sind einfach zu hoch und die Stückzahlen zu klein.
Mit Beispielen vorangehen
Wir müssen mit guten Beispielen vorangehen und den Förder- und Pädagogikeinrichtungen nahelegen, diese Beispiele zur Kenntnis zu nehmen und das Lesen und Schreiben der Brailleschrift in Bildungseinrichtungen intensiv zu fördern. Dies ist bei inklusiver Beschulung teilweise nicht mehr so einfach wie früher, als Blindenschulen mit Fachpädagogen gut ausgestattet waren. Mir berichten junge Leute, dass ihnen die Blindenschrift zu schwer falle und gerade die Kurzschrift unzumutbar zu lernen wäre. Sie erkennen den Nutzen nicht, weil sie weder ein Beispiel vor Augen haben, wie man die Blindenschrift nutzen kann, noch einen Lehrer, der ihnen die Technik mit einer ausreichenden Stundenzahl beibringt. Bei meinem Studium in den USA traf ich bereits vor 25 Jahren einen blinden Jurastudenten, der mir damals schon sagte, dass er die Brailleschrift wegen des PCs und JAWS nicht mehr benötige. Als er später bei Vorbereitungen, um Plädoyers zu halten, Notizen machen wollte, änderte sich seine Ansicht. Ich sollte ihm die Einleitung in Braille aufschreiben und ihm meine Tafel ausleihen, damit er während der Zeugenbefragung Notizen machen könne. Der Kommilitone hat später Brailleschrift gelernt.
Brailleschrift im Alltag
Ich möchte die Brailleschrift in meinem privaten und beruflichen Alltag nicht missen und nutze sie intensiv. Zwar nicht mehr mit Tafel, Steno- oder Bogenmaschine, wie wir es früher alle gelernt haben, sondern mit Braillezeile am PC und Braillenotizgeräten. Letztere haben die mobile Nutzung erheblich vereinfacht. Gerade unterwegs ist das Gehör so ausgelastet, dass ich froh bin, Zielorte oder genaue Straßenangaben direkt unter den Fingern lesen zu können. Dabei ersetzt das Smartphone für mich noch nicht die Braillezeile, weil man dort immer nachhören muss. Unterwegs oder in Besprechungen finde ich es sehr lästig und störend, wenn ich erst einmal mit Kopfhörer oder Lautsprecher hantieren müsste. Da empfinde ich es als sehr hilfreich, auf der Braillezeile etwas schnell nachlesen zu können, ohne dass mein Gehör abgelenkt wird. Auch die Umgebung bekommt so kaum mit, dass ich etwas nachgelesen habe.
Das Berliner Integrationsamt hat mir bei der Beantragung einer neuen Braillezeile und eines Notizgeräts entgegengehalten, dass es doch nicht mehr zeitgemäß sei, so teure Geräte anzuschaffen. Blinde könnten längst mit Smartphones ohne jede Zusatzhilfe und Zusatzsoftware arbeiten. Natürlich können Smartphones und Computer heute auch mit bestimmten Einstellungen weitgehend ohne sehende Hilfe bedient werden. Aber die Schrift bedeutet zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Zahlen, Formeln, tabellarische Übersichten sind schriftlich viel schneller und leichter zu erfassen.
Gleichberechtigte Teilhabe durch Schrift
Kein Sehender käme auf die Idee, den Bildschirm des PC oder des Smartphones durch bloße Sprache zu ersetzen. Es bedarf besonderer Konzentration, alles nur mit der Sprachausgabe zu machen, und es blendet die Umgebung aus. Wenn man also in einer Besprechung oder im Unterricht sitzt und nur die Kopfhörer aufhat, wird man von den anderen Teilnehmern nicht gleichberechtigt wahrgenommen und kann unter Umständen auch nicht folgen.
Ich nutze im Arbeitsalltag auch gern ausgedrucktes Braillematerial. Bei längeren Dokumenten oder Tabellendarstellungen finde ich eine Ganzseitendarstellung sehr hilfreich. Wenn man mit Kollegen gemeinsam an Dokumenten arbeitet und diese in einer Besprechung durchspricht, kann ein Ausdruck in Brailleschrift sehr nützlich sein, weil man dann ähnlich wie die sehenden Kolleginnen und Kollegen den genauen Wortlaut stets zwar nicht vor Augen, aber unter den Fingern hat.
Auch hier bewährt es sich, wenn man als blinde Person zeigt, dass man sich in den Arbeitsprozess integrieren kann. Man wird von den Sehenden ganz anders wahrgenommen, wenn man sprichwörtlich im Text ist.
Lese- und Schreibfähigkeit
Lesefähigkeit erhöht generell die Schreibfähigkeit. Auch hier kann die Blindenschrift ihren Beitrag leisten. Literatur, Gedichte, Geschichten wollen gelesen und zwischendurch auch vorgelesen werden. Ich nutze die Brailleschrift als ehrenamtlicher Lektor in der Kirche. Und schließlich gibt es ja auch professionelle blinde Vorleser, die die Punktschrift nutzen. Aber auch fürs gemeinsame Singen und Musizieren, selbst wenn man kein professioneller Musiker ist, kann man die Brailleschrift einsetzen. Mit Braillenotizgeräten muss man dafür auch keine 20 Bände Gesangbücher mehr mit sich herumtragen.
Die Erfindung
Die Diskussion über das Für und Wider der Brailleschrift gab es von Beginn an. Die Punktschrift hatte es nicht leicht, als Louis Braille sie 1825 erfand. Unter den blinden Mitschülern und erwachsenen Blinden damals ist sie sofort aufgegriffen und intensiv genutzt worden. Die einfache Lesbarkeit und die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln wie Stichel und Tafel die Schrift selbst zu schreiben, überzeugte sofort. Im Gegensatz zur Notenschrift hielten die Blindenpädagogen seiner Zeit aber lange daran fest, dass Blinde mit Reliefschrift in Büchern arbeiten sollten.
Als im Jahr 1840 der langjährige Direktor und Förderer Louis Brailles Dr. Pignier von seinem Stellvertreter Pierre-Armand Dufau abgelöst wurde, wurde nach jahrelanger Nutzung der brailleschen Punktschrift diese wieder in Frage gestellt. Er hielt nämlich nichts von der Blindenschrift, weil sie nach seiner Ansicht Barrieren zwischen Blinden und Sehenden aufbaute. Blinde sollten die gleiche Schrift verwenden wie Sehende. Das konnte dann aber nur eine Art Reliefschrift sein. Der Haken dabei ist, so eine Schriftdarstellung ist mit der Hand kaum zu schreiben und wesentlich schwerer mit den Fingern zu lesen als die Punktschrift. Glücklicherweise hielten sich die Schüler und Teile der Lehrer des Pariser Blindeninstituts nicht an das verordnete Verwendungsverbot. So musste der Leiter der Einrichtung 1844 anerkennen, dass die Brailleschrift nicht zu verhindern war. Eine öffentliche Vorführung bestätigte den überragenden Nutzen der Brailleschrift.
Verbreitung durch Blinde
Der Pädagogische Erfolg führte dazu, dass die Brailleschrift bereits ab den 1850er Jahren in vielen Ländern über die Schweiz, Belgien, Deutschland, Großbritannien und den USA mehr und mehr Verbreitung fand. Dies, obwohl viele Blindenpädagogen andere Schriften, Stachelschrift, Moon-Schrift oder das New Yorker Point-System bevorzugten.
Brailleschrift in Deutschland
Als im Jahr 1873 der Blindenlehrerkongress (Ein Vorläufer des heutigen Kongresses der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen) über die Frage der zu verwendenden Punktschrift beriet, konnte man sich nicht zwischen dem Point-System und der Brailleschrift entscheiden.
Erst bei einer europäischen Blindenkonferenz in Paris in Jahre 1878 legte man sich in Europa auf die Brailleschrift fest, wobei ein längerer Streit darüber entbrannte, ob jede Sprache auch die von Braille verwendeten Buchstabenkombinationen verwenden oder ob es nicht sprachspezifische Modifikationen geben sollte. Dies wurde glücklicherweise abgelehnt, so dass die Brailleschrift universal wurde.
In Deutschland wurde die einheitliche Brailleschrift auf dem Blindenlehrerkongress 1879 in Berlin beschlossen.
Es entstanden Bibliotheken wie die in Leipzig (1894), Hamburg (1905) und Marburg (1917). Die Hamburger Blindenbibliothek hatte beispielsweise 1919 einen Bücherbestand von 22101 Büchern. Aber auch die Leserzahl mit ca. 1500 war für heutige Verhältnisse beachtlich. Die Entwicklung danach kann hier nicht skizziert werden. Der Umfang von Braillebüchern nahm in Quantität und Qualität über 100 Jahre erheblich zu. Es besteht ein Reservoir an Material, das nutzlos würde, wenn die Brailleschrift nicht mehr beherrscht würde.
Nutzen der Brailleschrift wird angezweifelt
Heute diskutieren wir nicht mehr über Point oder Braille. Aber der Nutzen der Brailleschrift wird immer wieder einmal angezweifelt. Auch die Kurzschrift hat es schwer, obwohl jeder, der sie beherrscht, weiß, dass man damit nicht nur schneller schreiben, sondern auch wesentlich flüssiger lesen kann. In den USA wird selbst auf der Braillezeile die Kurzschrift verwendet, weil der Lesefluss besser ist.
Für die Beschriftungen in Bussen und Bahnen oder Aufzügen wird heute vermehrt die sog. Pyramidenschrift anstatt der Brailleschrift empfohlen. Dabei ist diese Reliefschrift nicht immer leicht zu ertasten. Die Brailleschrift signalisiert zugleich, dass man dort als Blinder etwas Lesbares finden kann.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Brailleschrift nicht nur als Kulturgut erhalten bleibt, sondern auch verbreitet wird, dass sie einen echten Mehrwert für Blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen hat. Wie früher ist es auch heute für Sehende nicht immer eingängig, dass eine so andersartige Schrift tatsächlich besser ist als ein bloßes Relief oder das Zuhören. Dies haben wir bei der Diskussion über die Kurzschrift in den letzten Jahren erlebt. Zum Glück ist es "nur" bei der Abschaffung einiger weniger Kürzungen geblieben. Es drohte Schlimmeres.
Wir sollten heute Social-Media-Plattformen, YouTube-Filme und andere Kanäle dazu nutzen, die umfangreichen Möglichkeiten der Brailleschrift, einschließlich Kurz-, Mathematik- und Notenschrift, zu verbreiten. Menschen mit Sehbehinderung und Blinde, die davon noch nichts wissen, werden es uns Danken.
Bild: Alltagshelfer: Dank der Speisekarte in Braille, die aufgeschlagen in einem Ordner auf dem Tisch liegt, sucht eine blinde Besucherin im Café in Ruhe ihre Bestellung aus. Foto: DVBS/Georg Kronenberg.
Aus der Arbeit des DVBS
N. Bongartz: Über die Sitzung des DVBS-Arbeitsausschusses 2024
Von Norbert Bongartz
Der Arbeitsausschuss des DVBS tagte vom 25.–27.10.2024 in Bad Soden-Salmünster. 21 stimmberechtigte Mitglieder (Bezirks- und Fachgruppenleiter sowie die der Interessengruppen) und etwa 25 Stellvertretungen nahmen teil.
Demokratie und politische Teilhabe stärken
Ein wichtiges Thema war die Auseinandersetzung mit dem zunehmenden Rechtsradikalismus in der Gesellschaft und seine Auswirkung auf die Situation blinder und sehbehinderter Menschen. Dr. Mohammad Reza Malmanesh, der an der Philips-Universität in Marburg zum Thema „Blinde unter dem Hakenkreuz“ promoviert hat (1), hielt einen Vortrag zur Lage blinder Menschen im Nationalsozialismus. Er zeigte Parallelen zur heutigen Ausgrenzung von Minderheiten auf. Auch Zitate von Politikerinnen und Politikern der Alternative für Deutschland (AfD) wurden diskutiert. Sie belegten nachdrücklich, dass die AfD die Rechte behinderter Menschen schwächen will.
Malmanesh betonte: Demokratie muss immer verteidigt werden – auch wenn das Bewusstsein dafür abnimmt. In seiner Doktorarbeit zeigte er, wie Blinde damals selbst an der Ausgrenzung jüdischer Menschen beteiligt waren. Der DVBS will das Thema Demokratie künftig stärker aufgreifen. Werner Wörder betonte, dass Demokratie und Inklusion immer verteidigt werden müssten, gerade wenn eine deutlich steigende Zahl dieses als nicht mehr wichtig zu erachten scheine. Offen blieb die Frage, wie der DVBS mit rechtsgerichteten Tendenzen umgehen soll, falls sie in den eigenen Führungsgremien auftauchen sollten.
Bericht des Vorstands
Vorstandsvorsitzender Werner Wörder berichtete über positive Entwicklungen. Ein großer Schritt ist der geplante Neustart der Webseite. Eine Arbeitsgruppe entwickelte das Konzept. Die Agentur „anatom5“ übernimmt die Umsetzung. Der Vorstand ruft zur Mitwirkung an den Inhalten auf.
Ein Schwerpunkt bleibt die Mitgliedergewinnung. Das vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) ausgerichtete Louis-Braille-Festival 2024 war dabei besonders erfolgreich. Fördermitglieder sollen künftig gezielt angesprochen werden – am besten im eigenen Bekanntenkreis.
Vorstandsmitglied Harald Schoen kritisierte den Stillstand in der Rechtspolitik. Auch wenn es politisch nicht vorangeht: Die Selbsthilfe muss gleiche Teilhabe weiterhin einfordern. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz tritt Mitte 2025 in Kraft (vgl. dazu die Beiträge von Uwe Boysen in horus 1/2025, S. 32 ff. / Brailleausgabe: S. 77 ff. und in dieser Ausgabe S. 36 ff. / Brailleausgabe: S. 240 ff.)
Berichte aus Gremien
Harald Schoen berichtete über die Europäische Blindenunion (EBU). Eine neue Zweigstelle in Brüssel soll den Kontakt zur EU-Kommission verbessern. Wolfgang Angermann, ehemals Präsident der EBU, wurde zu deren Ehrenmitglied ernannt.
Christine Beutelhoff vertritt den DVBS im Projekt „KI für ein gutes Altern“ der BAGSO. Vorstandsmitglied Leonore Dreves bringt die Sicht blinder Menschen in das Deutsche Komitee zur Verhütung von Blindheit ein.
Die Online-Seminarreihe „Ratschlag: Gute Arbeitsassistenz“ läuft weiter. Vorstandsmitglied Sabrina Schmitz koordiniert die Vorbereitung.
Aus der Geschäftsstelle
2023 fanden sieben Präsenzseminare mit 134 Teilnehmenden statt. 2024 gab es bislang fünf Seminare mit 118 Personen. Das Seminarangebot gilt als besondere Stärke des DVBS.
Finanzen
Der Jahresabschluss 2023 wurde vorgestellt. Die Finanzlage hat sich deutlich verbessert. Für 2024 wird ein Plus erwartet. Die Suche nach Fördermitteln ist aber weiterhin ein wichtiger Teil der Arbeit des Geschäftsführers.
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.
Wahlen des Leitungsteams
Norbert Bongartz wurde als Leiter des Arbeitsausschusses bestätigt. Neue Stellvertreter sind Dr. Andreas Wagner und Gabriele Bender. Dr. Heinz Willi Bach trat nicht erneut an. Die Versammlung dankte ihm herzlich für sein langjähriges Engagement.
Anmerkung
(1) Malmanesh, Mohammad Reza.: Blinde unter dem Hakenkreuz. Eine Studie über die Deutsche Blindenstudienanstalt e. V. Marburg und den Verein der blinden Akademiker Deutschlands e. V. unter dem Faschismus. Marburg, Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V. und Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg, 2002 (Marburger Schriftenreihe zur Rehabilitation Blinder und Sehbehinderter, Bd. 13). Als Hörbuch produziert in der Deutschen Blinden-Bibliothek, ausleihbar als Buchnr. 545942 (13 Stunden, 17 Minuten).
Rückenwind für die Öffentlichkeitsarbeit: DVBS erhält Förderung durch Betriebskrankenkassen
Die Öffentlichkeitsarbeit des DVBS ist ein kostenintensiver Faktor: Wenn es etwa darum geht, über die Anliegen blinder und sehbehinderter Menschen mit einem barrierefreien Flyer hinzuweisen, den Messestand pfiffig zu gestalten oder die Zeitschrift horus in verschiedenen Medienformen herauszugeben, ist es nahezu unmöglich, den Ausgaben X einen Faktor Y an Einnahmen gegenüberzustellen.
Umso erfreulicher ist es, wenn Förderanträge des DVBS bewilligt werden. So unterstützt die Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers (BKK PwC) den DVBS 2025 bereits zum dritten Mal im Rahmen der Selbsthilfe. Im letzten Jahr konnte durch ihren Förderbetrag etwa die Broschüre „Antrag auf…“ überarbeitet werden, die kostenlos über die DVBS-Geschäftsstelle erhältlich ist. Auch neue Rollups wurden rechtzeitig vor der SightCity fertig. Die PwC-Förderzusage, die nun im März 2025 einging, lässt DVBS-Geschäftsführer Elias Knell aufatmen: „Wir müssen alle Ausgaben mit spitzer Feder rechnen. Umso dankbarer bin ich über die Förderung der BKK PwC, die zur Entlastung unseres knappen Budgets beiträgt." Auf Einladung der BKK PwC konnte er sich am 21. März 2025 direkt in der Melsunger PwC-Zentrale bei Lars Grein, Geschäftsführer der BKK PwC, für die Unterstützung bedanken. Lars Grein hob während des Besuchs hervor, dass soziales Engagement ein zentraler Bestandteil der PwC-Unternehmensphilosophie sei. So unterstützt die BKK PwC neben dem DVBS auch die Aidshilfe Kassel und die Kinderhilfe in Fulda, um regional wichtige soziale Projekte nachhaltig zu fördern. Die BKK PwC wurde 1992 gegründet und hatte im Februar 2023 etwa 27.890 Versicherte. Die Krankenkasse ist primär für Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH und deren Familienangehörige (Ehegatten und Kinder) zugänglich.
Ein Weihnachtsgeschenk ganz besonderer Art war der Bewilligungsbescheid der Salus BKK, den Elias Knell Ende Dezember 2024 erhielt. Die Betriebskrankenkasse förderte damit ganz konkret die Herausgabe der Zeitschrift „horus“ in Blindenschrift 2024.
Ute Schrader, Vorständin der Salus BKK, erklärte anlässlich der Scheckübergabe am 19. Februar 2025 in der Salus-Hauptverwaltung Neu-Isenburg: „Dass die Salus BKK einen Beitrag dazu leistet, Menschen mit Sehbehinderung durch diese Zeitschrift nicht nur Wissen, sondern auch Hoffnung in barrierefreier Form an die Hand zu geben, macht dieses Förderprojekt für mich besonders.“
Die Salus BKK gehört mit über 350 Mitarbeitenden und über 169.000 Versicherten zu den bundesweit 25 größten Betriebskrankenkassen. Sie wurde 1895 als Betriebskrankenkasse der Philipp Holzmann AG gegründet.
„Für uns bedeutet die Förderung Rückenwind, angesichts steigender Druckkosten den horus auch weiterhin in Braille anzubieten“, so Elias Knell zur positiven Reaktion der Salus BKK. Und er betont: „Ich habe mich sehr über das freundliche Gespräch in Neu-Isenburg gefreut. Auch im Namen der Abonnentinnen und Abonnenten bedanke ich mich herzlich bei der Salus BKK für die Förderung des horus!“
2024 beteiligten sich dankenswerterweise auch die BKKen Herkules und ProVita an der Finanzierung des horus in Braille. 2025 unterstützen die Bahn BKK und BKK VerbundPlus den Brailledruck. Der DVBS hofft auf weitere Selbsthilfeförderungen.
Zur Kostendeckung der Braille-Ausgabe des horus hat der DVBS 2025 erstmals auch eine Spenden-Kampagne im Internet gestartet. Wer sich im Jubiläumsjahr der Brailleschrift 2025 beteiligen möchte, ist dazu herzlich eingeladen:
Bilder: oben: PwC-Geschäftsführer Lars Grein (re) begrüßt DVBS-Geschäftsführer Elias Knell (li) am 21.03.2025 in der PwC-Zentrale in Melsungen. Foto: DVBS. Unten: Salus BKK-Vorständin Ute Schrader (Mitte) und Elias Knell (rechts) halten symbolisch einen überdimensionalen Scheck, begleitet von Holger Tietz, Teamleiter Gesundheitsförderung (li). Foto: Salus BKK
Update der DVBS-Geschäftsstelle
„Hallo, hallo?“ Keine Antwort – ist denn niemand da? Die Telefonleitungen blieben stumm, es gab kein Durchkommen zur DVBS-Geschäftsstelle, auch nicht per Mail. Was war da los in der Marburger Frauenbergstraße Mitte Februar? Geschäftsführer Elias Knell erläutert im Gespräch die Hintergründe.
horus: Herr Knell, angekündigt war, dass in der DVBS-Geschäftsstelle am 10. und 11. Februar Arbeiten am Server anstehen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bis zwei Tage nicht erreichbar sein werden. Warum war die Aktion nötig?
Elias Knell: Grundsätzlich ist der Server eines der Herzstücke unserer digitalen Arbeit. Hierüber läuft der E-Mail-Verkehr, hier liegen unsere digitalen Unterlagen und darüber läuft die Telefonanlage. Der Server und die Firewall schützen unsere Daten und verwalten diese. Unsere alte Firewall wurde nicht mehr hinreichend durch Sicherheitsupdates unterstützt und der Wartungsvertrag zum Server lief auch aus, so dass dringender Handlungsbedarf bestand. Wir haben dann in einem Aufwasch Server und Firewall getauscht. Der neue Server ist leiser und verbraucht weniger Strom.
horus: Wie viel Vorlauf gab es, bis der Server schließlich erneuert werden konnte, woher kamen die finanziellen Mittel?
E.K.: Meine ersten Mails zu dem Thema sind über ein Jahr alt. Zunächst haben wir zu einem günstigeren, flexibleren IT-Dienstleister gewechselt, der Firma Trebaxa in Marburg, bevor wir den Umzug beginnen konnten. Die Rückkopplung mit dem Förderprogramm, die Antragsstellung und die Genehmigung der Mittel waren weitere Stufen, die zu erklimmen waren. Aber schlussendlich war es ein sehr positiver Prozess, bei dem wir gut von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt unterstützt worden sind.
horus: Gleichzeitig mit dem vorübergehenden Ausfall des Servers gab es in der DVBS-Geschäftsstelle zwei Tage lang kein Licht, und das in der eher noch dunklen Jahreszeit. Woran lag das?
E. K.: Ein nordhessisches Sprichwort sagt: „Wenn schon Sch…, dann mit Schwung.“ Wir hatten von der Berufsgenossenschaft den Hinweis auf einen nötigen E-Check, also die Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte, bekommen. Damit gingen planbar Erneuerungen in der Elektrik, wie z.B. Einfügen von Fehlerstromschutzschaltern in die Sicherungskästen, einher. Die FI-Schalter dienen letztlich dem Personen- und Brandschutz. Diese notwendigen Arbeiten haben wir in einem Förderprogramm mit der längst überfälligen Erneuerung der Beleuchtung kombiniert. Nun hat jeder Arbeitsplatz eine moderne LED-Beleuchtung, die nicht nur energiesparender, sondern auch deutlich heller ist. Unser Ziel war es, die Arbeiten zu koordinieren, um die Spanne der Nicht-Erreichbarkeit so kurz wie möglich zu halten. Die beteiligten Firmen haben sich sehr gut abgestimmt und so gab es keine Verzögerungen oder unerwartete Ausfälle.
horus: Die Kolleginnen und Kollegen waren trotz lahmgelegter Elektrik und EDV-Ausfall, Staub, Bohrlärm und Kabelwust in der Geschäftsstelle rührig. Sie selbst hatten Ihren Pick-up mit großer Ladefläche mitgebracht. Was war das Ziel?
E. K.: Wir haben uns gedacht: Wenn man schon Platz für die Handwerker schaffen muss, kann man die alten Dinge auch gleich entsorgen, statt sie zurück ins Regal zu stellen. So haben wir die Zeit genutzt, um im Sinne eines „Groß-Reine-Machens“ auch mal alte Akten in den Keller zu verlagern oder längst Überfälliges zu entsorgen. Mir hat es gut gefallen, dass alle zusammen angepackt und als Team unabhängig vom üblichen Tagesgeschäft gut funktioniert haben. Durch die Eigenleistung konnten wir auch nochmal Geld sparen, auch wenn der ein oder andere Muskelkater vom Tragen gehabt haben dürfte…
horus: Gut eine Woche nach der Installation der neuen Beleuchtung war am Donnerstag in der Geschäftsstelle noch einmal Muskelarbeit gefragt, es wurde geräumt, abgestaubt und geputzt, diesmal ging es um die Büromöbel. Wie kam es dazu?
E. K.: Antiquitäten mögen privat eine schöne Sache sein, aber Büromöbel sollten funktionieren. Bei vielen unserer sehr alten Aktenschränke klemmten die Rollos oder die Schlösser funktionierten gar nicht mehr. Sie waren einfach abgenutzt und alt. Durch einen sehr glücklichen Zufall hatte ich kurz vor unserer Renovierung einen Termin mit einer Anzeigen-Kundin des horus. Sie hatte eine gute Idee, und wenige Tage später konnte Frau Schlee aus vielen Möbeln der aufgelösten Polizeistation Wetzlar die für uns Passenden aussuchen. So haben wir neue Sideboards und Aktenschränke bekommen. Auch beim Transport hatten wir Glück: Das Umzugsunternehmen, welches mit der Polizei kooperiert, hat uns sehr günstig und zum Teil als Spende die Möbel die Treppen hinauf bis in die Büros geliefert. Jetzt haben alle Büros einen einheitlichen, professionellen Look und die alten Schränke werden in unserem Lager weiter genutzt.
horus: Wie hat sich die Arbeitsatmosphäre durch das Update verändert, sind Sie zufrieden?
E. K.: Ob ich zufrieden bin, ist weniger wichtig. Jeder, der hier arbeitet, soll sich wohlfühlen und eine gute, moderne, helle Arbeitsatmosphäre vorfinden. Wir haben als Selbsthilfeorganisation einen sehr hohen Anspruch an gut ausgestattete Arbeitsplätze, und ich finde, wir sollten diesem Anspruch auch selbst gerecht werden. Daher waren mir diese Neuerungen und Renovieren sehr wichtig, aber diese mussten auch finanziell darstellbar und förderfähig sein.
horus: Vielen Dank für das Gespräch.
C. Axnick: Seminare 2025
Von Christian Axnick
Folgende Seminare bietet der DVBS an:
24. – 27.07.2025, Fachgruppe Wirtschaft: Biografisches Theater.
Zugänge aus dem biografischen Theater und dem Psychodrama bieten hilfreiche Methoden an, um mehr Klarheit über Bedeutung und Auswirkungen der eigenen Behinderung im beruflichen Lebensweg zu erlangen. Bei diesen Methoden geht es aber nicht nur um die Aufarbeitung gemachter Erfahrungen, sondern sie eröffnen auch die Chance, eigene Wünsche und Pläne zu antizipieren, sie quasi einem Probehandeln zu unterziehen.
- 09. – 16.08.2025, Interessengruppe Ruhestand: Seminarwoche. Ort: Saulgrub.
04. – 07.12.2025, Fachgruppe Wirtschaft: Gesprächsführung und Gelassenheit – Zeit- und Selbstmanagement. Ort: Herrenberg-Gültstein
Sehbehinderte und blinde Menschen sind bei alltäglichen Gesprächen gehandicapt, da sie die Reaktion ihres Gesprächspartners auf dem optischen Kanal nur teilweise wahrnehmen. Der erste Seminarteil zeigt Wege aus diesen Schwierigkeiten und liefert die Grundlagen für selbstsicheres, kompetentes und gelassenes Verhalten in alltäglichen und kritischen Gesprächssituationen. Im zweiten Teil geht es darum, Tages- und Wochenarbeitszeit effektiver einzuteilen, Arbeitsabläufe besser zu planen, persönliche Schwachstellen zu erkennen und zu verändern.
Unsere Seminare stehen auch Nichtmitgliedern offen, sollten noch Plätze frei sein.
DVBS-Mitglieder mit geringem Einkommen und ohne institutionelle Förderung können einen Zuschuss aus unserem Solidaritätsfonds beantragen.
Aktuelle Termine der Seminare, aber auch der Stammtische, die virtuell oder in Präsenz stattfinden, gibt es auf der DVBS-Webseite unter
https://dvbs-online.de/angebote/termine.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
Kontakt
Christian Axnick
DVBS-Geschäftsstelle
Frauenbergstr. 8
35039 Marburg
Tel.: 06421 94888-28
E-Mail: axnick@dvbs-online.de
Für Kurzentschlossene: DVBS-Selbsthilfetage 2025
Die Veranstaltungen im Rahmen der DVBS-Selbsthilfetage vom 29. bis 31. Mai richten sich an alle DVBS-Mitglieder und finden in Marburg auf dem Campus der Deutschen Blindenstudienanstalt (blista), Am Schlag 2-12, statt. Start ist am Donnerstag, 29.05.2025, ab 19.00 Uhr mit einem „Stelldichein“ im blista-Speisesaal. Tags drauf treffen sich die Fach-, Interessen- und Projektgruppen in verschiedenen Räumen. Am Freitagabend gibt es ab 19.30 Uhr ein musikalisches Kulturprogramm. Am Samstag, dem 31.05.2025, findet in der Zeit von 09.00 Uhr bis gegen 15.30 Uhr in der Aula die DVBS-Mitgliederversammlung statt. Die Tagesordnung umfasst u. a. Vorträge, Vorstandswahlen und verschiedene Satzungsänderungsanträge.
Um Anmeldung wird gebeten (E-Mail: karges@dvbs-online.de; Tel.: 06421 94888-21).
DVBS-Mitglieder, die sich nicht angemeldet haben, können aber auch spontan an den Selbsthilfetagen teilnehmen. Es wird spannend!
Aus der blista
J. Flach: Leselust am Nachmittag - Spannende Abenteuer in der Welt der Bücher
Von Jens Flach
Stell dir vor, du tauchst ein in eine Welt voller spannender Geschichten, knisternder Buchseiten und Stimmen, die Worte lebendig werden lassen. Genau das erlebten die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 7 am 25. November 2024 bei der Veranstaltung „Leselust am Nachmittag“ an der blista. Überdies erhielten sie einen exklusiven Einblick in die Punktschrift- und Hörbuchproduktion hier bei uns im eigenen Hause – und das war alles andere als langweilig.
Nach vier erfolgreichen Terminen im vergangenen Schuljahr, bei denen die damaligen Jahrgangsstufen 7 bis 10 in die faszinierende Welt der Literatur eintauchen durften, war es nun an den aktuellen Siebtklässler*innen, sich von der Magie des Lesens und Hörens verzaubern zu lassen.
Live-Lesung mit Gänsehautmomenten
Höhepunkt einer jeden Leselust-Veranstaltung ist immer die Live-Lesung unserer Hörbuch-Sprecher*innen, die mit ihren ausdrucksstarken Stimmen und schauspielerischen Talenten die Zuhörenden fesseln. Auszüge aus Büchern wie „Erebos“ von Ursula Poznanski, „Land of Stories“ von Chris Colfer oder „Harry Potter und der Orden des Phönix“ von J.K. Rowling sorgten in der Vergangenheit beispielsweise schon für Spannung, Staunen und jede Menge Gesprächsstoff.
Besonders aufregend ist, dass die vorgelesenen Titel zuvor von den Klassen selbst ausgewählt werden dürfen – das macht die Geschichten noch persönlicher. Nach der Lesung stehen die Sprecher*innen und ihre Berufung im Mittelpunkt: Die Schüler*innen stellen immer wieder interessierte Fragen wie „Wie wird man eigentlich Hörbuchsprecher*in?“ oder „Ist es schwer, bei traurigen Szenen nicht selbst mitzuweinen?“
Hinter den Kulissen der Buchproduktion
Zwischen den zwei Lesungen geht es auf eine spannende Entdeckungsreise hinter die Kulissen. In den Studios der Hörbücherei können sich die Jugendlichen selbst als Sprecher*innen ausprobieren und erleben, wie sich ihre Stimmen in schalldichten Kabinen anhören. Im Kontrollraum wird gezeigt, wie jede Aufnahme überwacht und perfektioniert wird.
Auch ein Besuch in der Braille-Druckerei darf nicht fehlen. Hier erleben die Schüler*innen, wie riesige Maschinen Bücher und Zeitschriften für Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung herstellen. Besonders beeindruckend: Die Maschinen arbeiten mit Papierrollen, die ausgerollt 4,2 Kilometer lang sind – eine Dimension, die sich viele kaum vorstellen können.
Bücher für die Hosentasche – Die blista Leselust-App
Ein zentraler Programmpunkt ist die Vorstellung der blista Leselust-App, die Menschen mit Blindheit, Sehbehinderung oder Lesebehinderung kostenlosen Zugang zu tausenden Hörbüchern auf dem Smartphone bietet. Es ist erstaunlich, wie einfach die App zu bedienen ist und wie vielseitig das Angebot reicht – von aktueller Jugendliteratur bis hin zu Klassikern. Es können nicht nur Werke gestreamt und downgeloadet werden, sondern auch die Bestellung von Hörbüchern auf CD und Ausgaben in Braille-Schrift ist bequem möglich.
Literatur wird lebendig
„Ich fand es richtig toll, mal selbst in einem Studio zu sprechen“, erzählte ein Schüler begeistert nach der Veranstaltung. Eine andere Teilnehmerin meinte: „Wenn ein Buch so toll vorgelesen wird, geht es echt richtig unter die Haut!“
Nach den erfolgreichen Veranstaltungen im vergangenen Schuljahr hat „Leselust am Nachmittag“ auch diesmal erneut bewiesen, wie kreativ Literatur vermittelt werden kann. Die Mischung aus Lesungen, Einblicken in die Produktion und interaktiven Erlebnissen hat die Begeisterung für Geschichten neu entfacht.
Die Veranstalter*innen Andrea Katemann, Dorothea Kuhnert, Ellen Taubner und Jens Flach blicken zufrieden auf den Tag zurück – und die Schüler*innen nehmen nicht nur tolle Eindrücke, sondern vielleicht auch die Lust auf das nächste Abenteuer in der Welt der Bücher mit. Daher wird die Reihe auch in Zukunft für alle neuen siebten Klassen durchgeführt werden.
Auch du möchtest die Leselust-App?
Die blista Leselust-App kann einfach im Google Play Store oder im Apple Store heruntergeladen werden. Die Anmeldung ist für alle Schüler*innen der Carl-Strehl-Schule ganz einfach möglich. Holt euch eure Zugangsdaten...
per E-Mail an info@blista.de
am Telefon unter 06421 606-0
oder im Büro von "Auskunft und Beratung" im Gebäude Am Schlag 8.
Wer nicht Schüler*in an der Carl-Strehl-Schule ist, kann sich ebenfalls für die blista Leselust-App anmelden. Dafür benötigt man:
- Einen Nachweis über die Behinderung, der entweder per Post oder digital an uns geschickt werden kann. Es genügt der Behindertenausweis mit dem Merkzeichen bl. Es wird auch ein ärztliches Attest akzeptiert, das die nicht vorhandene Lesefähigkeit bescheinigt.
- Die ausgefüllten Anmeldeunterlagen, die wir zusenden. Diese enthalten auch die Leihordnung. Falls Hilfe beim Ausfüllen benötigt wird, kann man sich gerne telefonisch unter 06421 606-0 melden.
Bild: Blick durch zwei schalldichte Fenster in eine Studiokabine mit drei Siebtklässlern. Einer der Schüler sitzt mit Headset vor dem Mikrofon, ein anderer winkt fröhlich. Foto: blista
F. Stollenwerk: Elf Absolvent*innen der Reha-Fachschule starten in den neuen Beruf
Von Frank Stollenwerk
Elf Studierende haben ihre Weiterbildung zur "Staatlich geprüften Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation" an der Fachschule der blista im Februar erfolgreich abgeschlossen – davon acht mit dem Schwerpunkt Orientierung und Mobilität (O&M) und drei mit dem Schwerpunkt Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF). Am 28.02. erfolgte in einer kleinen Feierstunde die Übergabe der Zeugnisse, zu der sogar Peter Brill (Geschäftsführer des Bundesverbandes der Rehabilitationslehrer*innen für Blinde und Sehbehinderte e. V.) – in Vertretung der Vorsitzenden Maria Schüller – eigens aus Schwerin angereist war.
Der Vorstandsvorsitzende der blista, Patrick Temmesfeld, beglückwünschte die Absolvent*innen zu ihrem erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung und wünschte ihnen einen guten Start in den neuen Beruf. Er hob die Bedeutung des Berufes für die Unterstützung der Autonomie und aktiven Teilhabe von Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung hervor. Angesichts des dramatischen Fachkräftemangels in diesem Bereich müsse die Ausbildungskapazität erweitert werden, um künftig deutlich mehr Reha-Fachkräfte zu qualifizieren.
Dr. Werner Hecker, Ressortleiter der Rehabilitationseinrichtung (RES) und Leiter der Fachschule, drückte den Absolvent*innen seinen großen Respekt aus. Die Weiterbildung verlange den Teilnehmenden nicht nur fachlich, sondern auch persönlich viel ab. Alle Absolvent*innen hätten ein außerordentliches Engagement und in ihrem Unterricht mit den blinden und sehbehinderten Klient*innen ein hohes Verantwortungsgefühl gezeigt. So hätten sie den Unterricht mit ihren blinden und sehbehinderten Klient*innen auch nach der letzten Prüfung freiwillig bis zum letzten Tag der Weiterbildung fortgeführt, obwohl dies formal gar nicht mehr verlangt war. Dr. Hecker dankte auch dem Ausbildungs-Team der blista, das es erneut geschafft habe, die Teilnehmenden in der kurzen Zeit von einem Jahr für ein für sie völlig neues Berufsbild zu qualifizieren.
Der Abteilungsleiter Frank Stollenwerk betonte, dass es wichtig sei, angesichts des Fachkräftemangels das Berufsbild bekannter zu machen, die Ausbildungsmöglichkeiten zur Reha-Fachkraft zu stärken, nach neuen Wegen zu suchen und die Politik von der Notwendigkeit einer Finanzierung zu überzeugen. Dafür könnten alle Reha-Fachkräfte Multiplikator*innen sein.
Die Teams der Reha-Fachkräfte der blista aus den Abteilungen RES-Unterricht und RES-Ausbildung überreichten den Absolvent*innen als kleines Geschenk jeweils eine Unterschriftenschablone aus Metall „am Bande“ als kleinen Orden.
Der offizielle Teil der Zeugnisübergabe klang bei Getränken und Snacks aus.
Da Reha-Fachkräfte in Deutschland händeringend gesucht werden, haben fast alle Teilnehmer*innen ihren Arbeitsvertrag „in der Tasche“ oder starten in ihre freiberufliche Tätigkeit.
Die blista freut sich über die Kollegin Melanie Goka, die nun zusätzlich zu ihrer bereits vorhandenen O&M-Qualifikation den Abschluss im Schwerpunkt LPF erreicht hat.
Bild: Die Absolvent*innen v.l.n.r.: Nicole Balkau, Romina Dohrn, Constance Tressin, Arila Täubrich, Greta Ebert, Friederike Tonino, Tanja Schmidt, Ulrike Zitzmann, Melanie Goka, Benjamin Wies, Tabea Scott. Foto: blista
Th. Büchner: "So tatkräftig wie kreativ": Große Auszeichnung für ehemaligen blista-Vorstand Claus Duncker
Von Thorsten Büchner
Während seiner „Ortszeit“ im mittelhessischen Stadtallendorf hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zehn Persönlichkeiten aus Hessen für ihr herausragendes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Zu den Geehrten gehörte auch der ehemalige blista-Vorstand Claus Duncker.
Der Bundespräsident hob in seiner Laudatio die besonderen Verdienste von Claus Duncker zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung hervor. „Dass blinde und sehbehinderte Menschen die Herausforderungen in der Schul- und Arbeitswelt meistern, das hat sich Claus Duncker zur Lebensaufgabe gemacht. Als Lehrer und bis 2022 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Blindenstudienanstalt hat er sich so tatkräftig wie kreativ dafür engagiert, dass gesellschaftliche Teilhabe für alle keine Utopie ist. Auf Claus Duncker gehen zahlreiche Initiativen zurück, die im besten Sinne Schule gemacht haben, seien es neue Studiengänge für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, Erwachsenenbildung oder das Konzept der „umgekehrten inklusiven Beschulung“. Bis heute bringt er sich in der Christoffel-Blindenmission ein und trägt unermüdlich dazu bei, dass die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention in greifbare Nähe für Betroffene rücken.“
Patrick Temmesfeld, Nachfolger im Amt des Vorstandsvorsitzenden der blista, freute sich ganz besonders über „diese großartige Wertschätzung, die Claus Duncker so für sein Maßstäbe setzendes Engagement entgegengebracht wird“.
Claus Duncker habe in seinen 15 Jahren an der blista-Spitze „so viel angeschoben und vorangebracht, von dem wir heute noch tagtäglich profitieren“. So trage der heutige blistaCampus als inklusiver Bildungscampus ganz klar die Handschrift von Claus Duncker. „Innovativ, initiativ und schnell. So würde ich das Wirken von Claus Duncker in drei Worten zusammenfassen. Schön, dass dieser leidenschaftliche Einsatz gesehen und mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird“, charakterisiert Patrick Temmesfeld die Talente seines Vorgängers.
Seit vielen Jahren engagiert sich Claus Duncker auch im Aufsichtsrat der renommierten „Christoffel-Blindenmission“ (CBM), derzeit als Vorsitzender, um auch Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung aus dem globalen Süden mehr Teilhabechancen zu ermöglichen. Darüber hinaus war und ist Claus Duncker vielfältig in der Marburger Stadtgesellschaft engagiert. Ganz nach seinem Motto, das er zu seinem Abschied als Vorsitzender der blista im Magazin „blista-News“ formulierte: „Neu entwickeln, neu aufbauen und sich vernetzen. Das ist genau mein Ding!“
Bundespräsident Steinmeier bedankte sich bei allen frisch gebackenen Ordensträger*innen: „Sie geben anderen Menschen Kraft und Hoffnung.“ Hier seien die Mutmacher*innen und Bessermacher*innen versammelt, die nun mit der höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik für ihr Wirken geehrt werden.
Claus Duncker bedankte sich für die Anerkennung und Auszeichnung durch den Bundespräsidenten. „Es freut mich sehr, dass der Bundespräsident mit der Verleihung des Verdienstordens dem Einsatz für mehr gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung zu mehr Aufmerksamkeit verhilft. Sich dafür einzusetzen, zusammen mit der Selbsthilfe, hat mir viel Freude gemacht und gehört zu den prägendsten Erfahrungen meines Lebens.“ Duncker hofft, dass die Auszeichnung „für einige Menschen vielleicht ein Ansporn sein kann, sich gesellschaftlich zu engagieren“.
Bild: Feierliche Ordensverleihung am 20. März 2025 in der Stadthalle Stadtallendorf an Claus Duncker: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (li) und Claus Duncker (re) stehen nebeneinander und zeigen lächelnd die Urkunde und den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Im Hintergrund ein schwarzer Vorhang und die Deutschlandfahne. Foto: Bundesregierung/Jesco Denzel
Bücher
T. Büchner: Hörbuchtipps aus der blista
Von Thorsten Büchner
Hörbücher der DBH
Ronald Reng: 1974 - eine deutsche Begegnung. Als die Geschichte Ost und West zusammenbrachte.
Piper, München, 2024. Buch-Nr.: 1626041, Spielzeit: 863 Minuten.
Selten gibt es Augenblicke in der Geschichte, die wie ein Brennglas wirken. Das einzige Fußballspiel zwischen der DDR und der BRD ist ein solcher herausragender, brisanter und zugleich universaler Moment. Als sich am 22. Juni 1974 die Mannschaften beider Staaten im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion begegneten und die DDR durch ein 1:0 von Jürgen Sparwasser den Sieg davontrug, brachten der Zufall und die Zeitläufte Menschen und Ereignisse zusammen, die Einfluss nahmen auf das Leben nicht nur der Beteiligten, sondern auf beide Länder und ihre Menschen. Davon erzählt Ronald Reng auf unvergleichlich fesselnde und kluge Weise. Sein Buch ist ein bestechendes Zeugnis gesamtdeutscher Alltagsgeschichte.
Kathy Reichs: Totgeglaubte leben länger
Random House, München, 2014. Buch-Nr.: 1620381, Spielzeit: 851 Minuten.
Die Leiche eines zwielichtigen Importeurs beschert Tempe Brennan Überstunden im Labor. Die Schusswunde am Kopf deutet auf Selbstmord hin, doch die Gerichtsmedizinerin kann ein Verbrechen nicht ausschließen. Als ein Fremder ihr das Foto eines uralten Skeletts aus Israel zusteckt und beteuert, es sei der Schlüssel zum Tod des streng religiösen Kaufmanns, stößt Tempe auf ein abgründiges Geheimnis, das älter ist als die Bibel...
Richard Hemmer/Daniel Meßner: Geschichten aus der Geschichte. Eine Reise um die Welt zu außergewöhnlichen Persönlichkeiten, vergessenen Ereignissen und sagenhaften Entdeckungen
Piper, München, 2023. Buch-Nr.: 1617551, Spielzeit: 552 Minuten.
Die Historiker Richard Hemmer und Daniel Meßner beschäftigen sich täglich mit Geschichten, die hinter spannenden wie kuriosen Erkenntnissen und Fragen stehen. In ihrem Buch nehmen sie uns mit auf eine Zeitreise um die Welt in 20 Geschichten, und zeigen in unvergleichbar unterhaltsamer Manier historische Zusammenhänge zwischen großen Entdeckungen, waghalsigen Abenteuern und beeindruckenden Errungenschaften auf - vom frühen Mittelalter bis zur Neuzeit, von der Arktis bis zum Südpolarmeer. Das Buch zum gleichnamigen, erfolgreichen Podcast.
Hans-Günter Heiden: Behindertenrechte in die Verfassung! Der Kampf um die Grundgesetzergänzung 1990-1994
Juventa, Weinheim, 2024. Buch-Nr.: 1632301, Spielzeit: 624 Minuten,
Die Ergänzung des Grundgesetzes in Artikel 3 um den Satz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" war Anfang der 1990er Jahre hart umstritten. Mit dem Argument, das Grundgesetz dürfe nicht zum „Warenhauskatalog“ verkommen, wurde die Forderung der Behindertenbewegung von der Regierung abgelehnt. Erst im Wahlkampf 1994 kam der Umschwung: Mit überwältigender Mehrheit beschloss der Bundestag am 30. Juni 1994 die neue Verfassung. Der vorliegende Band zeichnet den erfolgreichen Kampf der Behindertenbewegung aus der Perspektive eines damaligen Aktivisten und Zeitzeugen nach.
Hörbuchtipps zum Schwerpunktthema „Tierisch, tierisch“
Detlef Berentzen: Blindenführhunde. Kulturgeschichte einer Partnerschaft
Ripperger und Kremers, Berlin, 2016. Buch-Nr.: 81062,1 Spielzeit: 465 Minuten.
„Wer nichts sieht, wird nicht gesehen / Wer nichts sieht, ist unsichtbar“, schrieb Erich Kästner 1931 in seinem Gedicht „Der Blinde an der Mauer“. Für Blinde, die mit einem Führhund unterwegs sind, hat diese Wahrheit keine Geltung mehr: Der Führhund macht sichtbar. Und er sieht. Für seinen Menschen - nicht umsonst nennt man den Führhund in den USA auch „Seeing Eye Dog“. Wie und unter welchen Umständen blinde Menschen zunehmend auf den Hund kamen, erzählt dieses Buch.
Anja Rützel: Saturday Night Biber
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main, 2017. Buch-Nr.: 828401, Spielzeit: 392 Minuten.
Die Journalistin Anja Rützel nähert sich den von ihr favorisierten Tierarten auf ganz ungewöhnliche Art und Weise: Hirschfütterung bei Minusgraden hoch über dem Gasteiner Tal in Österreich, ein Kurs bei einer Alpaka-Flüsterin, ein Praktikum bei einem Schabenforscher oder die Ausbildung zur Biberberaterin. Sie lernt Falken zu präparieren, probiert Kuhkuscheln in Norddeutschland und berichtet in neun Reportagen über all diese teils sehr skurrilen Erfahrungen unterhaltsam, witzig und selbstironisch.
Kontakt und Bestellungen
Deutsche Blindenstudienanstalt e.V.
blistaCampus
Am Schlag 2-12
35037 Marburg
Tel.: 06421 606-0
E-Mail:info@blista.de
Barrierefreier Online-Katalog:
https://katalog.blista.de
und kostenlose Leselust-App
W. Lutz-Gemril, J. Schäfer: Aus der Braille-Druckerei
Braille for Kids - die Super-Quizshow für junge Leute rund um unsere Neuerscheinungen (2. Staffel)
Von Wencke Lutz-Gemril und Jochen Schäfer
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres Braille-Quiz! Ihr könnt Euch auch dann beteiligen, wenn ihr die erste Staffel nicht mitgemacht habt. Ihr kommt eine Runde weiter, wenn ihr jetzt die richtigen Antworten findet. Zu gewinnen gibt’s natürlich auch was, und das hat mit Lesen und Punktschrift zu tun. Genaueres verraten wir in Staffel drei – die Spannung muss ja noch aufrecht erhalten bleiben. Wenn ihr euch am Quiz beteiligen wollt, schreibt einfach eine E-Mail an: info@blista.de oder ruft uns an unter: 06421 606-0. Die Kontaktdaten geben wir unten nochmal an.
Diese Staffel ist eine echte „Gangsterrunde“, denn wir stellen euch Bücher vor, in denen es um Gangster und Diebe geht.
David Walliams: Gangsta-Oma
Rowohlt, Reinbek, 2016. 3 Bände in reformierter Kurz- und Vollschrift. Bestell-Nr. 6347.
Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine tanzverrückten Eltern das Tanzbein schwingen. Bens Oma ist zwar nett, aber sooooooo langweilig! Immer will sie bloß Scrabble spielen und isst den ganzen Tag nichts anderes als Kohlsuppe - igitt! Doch eines Tages findet Ben heraus, dass seine Oma ein Geheimnis hat: Sie war früher eine berühmte Diebin und plant jetzt ihren größten Coup. Ben ist Feuer und Flamme. Was für ein Abenteuer! Von nun an können die Freitage gar nicht schnell genug kommen. Ein aufregendes Buch für Jungen und Mädchen ab 10, das Spannung pur verspricht.
Quiz-Fragen
- Worauf hat es die Oma als Diebin besonders abgesehen?
- Auf Geld?
- Auf Juwelen?
- Auf wertvolle Sammlerstücke?
- Welchen großen Coup plant Oma? Will sie
- eine Bank überfallen?
- die Kronjuwelen der englischen Königin stehlen?
- Sammlerstücke aus einem berühmten Museum klauen?
Charlotte Habersack: Bitte nicht öffnen, Bd. 7-9
Carlsen, Hamburg, 2022-24.
Nemo und seine Freunde Fred und Oda aus Boring bekommen noch immer geheimnisvolle Pakete, die vor Nemos Haustür liegen. Im ersten Paket wimmelt es von winzigen, wieselflinken Wesen, sogenannten „Maipupus“, und in der ganzen Stadt hagelt es Bonbons. Das zweite Paket ist leer und zerfetzt, aber in der ganzen Stadt finden die Freunde fiese, kratzige Krallenspuren, die auf ein weiteres Spielzeug hindeuten. Im dritten Abenteuer ist Nemos geliebtes Kuscheltier, Kasimir Knautschowski Käsebauch, plötzlich verschwunden und taucht in einem neuen Paket auf. Natürlich müssen die Freunde Kasi retten, bevor ganz Boring zur knautschigen Hüpfburg wird. Ja, dieser Spielzeugdieb ist gerissen und geschickt, und den Kindern gelingt es nicht, ihn dingfest zu machen - oder etwa doch?
Neu erschienen sind: Bd. 7: Winzig! (Bestell-Nr. 6307), Bd. 8: Kratzig! (Nr. 6352), Bd. 9: Knautschig! (Nr. 6384). Alle 3 Abenteuer umfassen in Vollschrift 3 Bände, in reformierter Kurzschrift: „Winzig!“ 3, die anderen 2 Bände.
Quiz-Fragen
- Wer ist der Hauptverdächtige als Spielzeugdieb?
- Franz Ach, Borings Bürgermeister?
- Herr Siebzehnrübel, der Spielwarenhändler?
- Hubsi Hubert, der berühmte Radio-Wettermann?
- Wird der Spielzeugdieb dingfest gemacht?
- Ja
- Nein
- Bleibt bis zum Schluss ungeklärt
Wir wünschen euch ganz viel Glück und gutes Gelingen beim Raten.
Kontakt (Bestellungen und Quiz)
Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista)
blistaCampus
Am Schlag 2-12
35037 Marburg
Tel.: 06421 606-0
E-Mail: info@blista.de
oder über unseren barrierefreien Online-Katalog
https://katalog.blista.de
bzw. die populäre App „Leselust“
Panorama
Geführte Rundgänge im Zoo Heidelberg
Die Zoo-Akademie Heidelberg bietet seit diesem Jahr Themenführungen für blinde und sehbehinderter Erwachsene sowie für hörbeeinträchtigte und gehörlose Erwachsene an. Die Rundgänge werden von Rangern mit spezieller Zusatzausbildung geführt.
Blinde und sehbehinderte Menschen erfahren während des Rundgangs alles über „Bär, Schneeeule, Löwe & Co“. Ein Ranger hat eine Vielzahl an Materialien im Gepäck, damit der Rundgang mit weiteren Sinnen erlebbar ist. Dazu gehören Materialien zum Fühlen, wie beispielsweise Federn, unterschiedlich weiche Felle, Knochen oder Schädelnachbildungen. Es werden auch verschiedene Tierstimmen zu hören sein.
Den Rundgang für hörbeeinträchtigte und gehörlose Menschen begleitet ein Dolmetscher für Gebärdensprache. Hier sind ebenfalls spannende Objekte zum Anschauen und Begreifen dabei, um die Themenführung rund um „Trampeltier, Erdmännchen & Co“ abwechslungsreich zu gestalten.
Beide barrierefreien Rundgänge dauern jeweils 90 Minuten. Die Ticketgebühr beträgt € 7,00 pro Person zuzüglich Zoo-Eintritt. Der Zoo kann vor oder nach der Tour auf eigene Faust besucht werden.
Nähere Infos finden Sie online unter
https://www.zoo-akademie.org/de/angebot/themenfuehrung-fuer-erwachsene
Bundesteilhabegesetz endlich umsetzen und weiterentwickeln!
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im Februar als Ergebnis der Evaluationen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einen Abschlussbericht der Wirkungsprognose und einen Abschlussbericht der Finanzuntersuchung veröffentlicht.
Die Umsetzung des BTHG wurde über fünf Jahre umfassend begleitet. Die Ergebnisberichte zeigen jedoch, dass die Leistungen nicht immer bei den Menschen mit Behinderung ankommen, kritisieren die Fachverbände für Menschen mit Behinderungen. Sie fordern, dass Bund und Länder deutlich aktiver werden, damit das Versprechen des BTHG auf mehr Teilhabe eingelöst wird, und haben Vorschläge und Anwendungshinweise ausgearbeitet. Zum Beispiel sollten die tatsächlichen Kosten der Unterkunft für Menschen mit Behinderung übernommen werden und Leistungen bürokratiearmer und schneller gewährt werden
Die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung, zu denen z. B. die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. gehört, repräsentieren ca. 90 % der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, seelischer, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Deutschland.
Die Stellungnahme ist zugänglich unter:
www.diefachverbaende.de/files/stellungnahmen/20250303_PP_BTHG_FV.pdf
REHADAT-Verzeichnis 2025 erschienen
In der aktuellen Ausgabe von „Rehabilitations- und Teilhabeforschende – Akteurinnen, Akteure und Themen in Deutschland 2025“ wird die beeindruckende Zahl von 263 Persönlichkeiten aufgeführt. Es sind Reha-Forschende aus allen Fachdisziplinen der Rehabilitation, Teilhabe und Inklusion.
Das Verzeichnis zeigt, wer zu welchen Themen arbeitet. So beschäftigen sich viele Forschende aktuell auf vielfältige Art damit, ob und wie eine digitale Transformation im Rahmen der Rehabilitation und Teilhabe nutzbar gemacht werden kann, beispielsweise durch Virtual Reality, KI oder eine partizipative Technologieentwicklung.
Das Verzeichnis wird jährlich herausgegeben und steht zum kostenfreien PDF-Download im REHADAT-Portal bereit. Zur Aufnahme in das Verzeichnis können sich Interessierte an Hannah Milena Seichter, E-Mail: seichter@iwkoeln.de, Tel.: 0221 4981-514, wenden. REHADAT ist ein Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e. V. und wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aus dem Ausgleichsfonds gefördert.
Die Online-Übersicht der Forschenden ist abrufbar unter:
https://www.rehadat-forschung.de/de/forschende/reha-teilhabeforschende
Kreativwettbewerb: "Siehst Du mich? - Die Lebenswelten von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung"
Der Evangelische Bundesfachverband für Teilhabe und die Fürst Donnersmarck-Stiftung schreiben zum zweiten Mal den Kreativwettbewerb „Siehst Du mich?“ aus. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Vielfalt von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sichtbar zu machen und ein Zeichen für eine inklusive Gesellschaft zu setzen.
Der Wettbewerb möchte hierfür künstlerische Perspektiven und Stimmen sammeln und präsentieren. Ob Mode, Musik, Poesie oder Performance – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Als Beitragsformate sind unter anderem Fotos und Fotoreportagen (max. 5 Minuten), Podcasts, schriftliche Beiträge (max. 1.000 Wörter) oder andere digitale Formate möglich.
Teilnehmen können Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie Unterstützer*innen und Initiativen, die sich für Teilhabe und Inklusion einsetzen. Besonders berücksichtigt werden Arbeiten, die von inklusiven Tandems erstellt werden. Einsendeschluss für Beiträge ist der 15. Juni 2025, E-Mail für Einsendungen und Fragen: kreativwettbewerb@beb-ev.de
Weitere Informationen gibt es auf
https://beb-ev.de/projekte/kreativwettbewerb-2025/
Deutsche Hörfilme mit Auszeichnung
Prominente aus Film und Fernsehen, Wirtschaft und Politik, erwarteten mit Spannung am 25. März 2025 in Berlin, welche der insgesamt 22 nominierten Hörfilme mit dem Deutschen Hörfilmpreis ausgezeichnet werden sollten. Der Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) vergab den Preis zum 23. Mal, dieses Jahr jedoch erstmals im historischen Colosseum Filmtheater. Moderiert wurde der Gala-Abend von Nadine Heidenreich. Audiodeskription (AD) ist eine Kunst, mit der blinden und sehbehinderten Menschen unaufdringlich und präzise in Dialogpausen beschrieben wird, wie zentrale Elemente der Filmhandlung, aber auch Gestik, Mimik und Dekor, aussehen. Die Auszeichnungen, jeweils eine ADele-Figur aus Bronze, war für sechs Film-Kategorien reserviert.
Eine ADele für die beste Audiodeskription erhielten jeweils; „Vena“ (Kategorie Spielfilm Kino), „Ein Mann seiner Klasse“ (Kategorie Spielfilm TV/Mediatheken/Streaming), „Ich bin Dagobert“ (Kategorie Serie), „Wish“ (Kategorie Kinder- und Jugendfilm), „Unsere Wälder – Netzwerk der Tiere“ (Kategorie Dokumentation) und „Paris, Texas“ (Kategorie Filmerbe). Der begehrte Publikumspreis ging an die Kinder- und Jugendfilm-Produktion „Sieger sein“.
Mit dem Deutschen Hörfilmpreis zeichnet der DBSV seit 2002 herausragende Hörfilme und Projekte, die diese barrierefreien Filmerlebnisse voranbringen, aus.
Mehr über die Auszeichnung und die diesjährige Veranstaltung finden Sie auf https://deutscher-hoerfilmpreis.de/hoerfilmpreis-2025.html
Impressum
Jg. 87 der Schwarzschriftausgabe
Jg. 99 der Brailleausgabe
Herausgeber: Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. (DVBS) und Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista)
ISSN 0724-7389
V. i. S. d. P.: Andrea Katemann (DVBS) und Thorsten Büchner (blista)
Verlag: DVBS, Frauenbergstr. 8, 35039 Marburg, Tel.: 06421 94888-0, E-Mail: horus@dvbs-online.de, Web: dvbs-online.de
Redaktion: Für den DVBS: Peter Beck, Leonore Dreves und Andrea Katemann. Für die blista: Isabella Brawata, Thorsten Büchner und Amélie Schneider.
Koordination: DVBS, Sabine Hahn.
Brailldruck: Deutsche Blindenstudienanstalt e. V.
Digitalisierung und Audio: DVBS.
Print: Druckerei Schröder, Lindauer & Wolny GbR
horus erscheint vierteljährlich in Braille, Print und digital (mit DAISY-Hörfassung, HTML sowie Braille-, RTF-, Word- und PDF-Dateien).
Jahresbezugspreis: 42 Euro (Versandkosten Inland inklusiv). Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen. Für Mitglieder des DVBS ist der Bezug im Jahresbeitrag enthalten.
Bankkonto des DVBS:
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE42 5335 0000 0000 0002 80
BIC: HELADEF1MAR
Beiträge und Bildmaterial schicken Sie bitte ausschließlich an den DVBS, Redaktion. Bitte geben Sie an, falls Ihr Beitrag bereits in anderen Zeitschriften veröffentlicht wurde oder für eine Veröffentlichung vorgesehen ist. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Redaktion.
Die Herausgabe des horus in Braille wird 2025 von der BAHN-BKK und der BKK Verbund-Plus unterstützt.
Vorschau horus 3/2025
Schwerpunkt: „Alles, was Recht ist“
Erscheinungstermin: 25.08.2025
Anzeigenschluss: 18.07.2025
Redaktionsschluss: 20.06.2025
Anzeigen
Textanzeigen
Private Kleinanzeigen bis zu einer Länge von 250 Zeichen werden kostenlos abgedruckt. Danach werden 20 Euro pro angefangene 250 Zeichen berechnet. Für die korrekte Wiedergabe ihres Inhalts (z. B. Namen, Anschriften usw.) kann keine Haftung übernommen werden.
Für gewerbliche Anzeigen oder Beilagen senden wir Ihnen gerne die horus-Mediadaten zu.
(priv.) Hilfsmittel privat zu verkaufen: 1. Hims Polaris 32 Notizgerät, 2. Hims Braille Sense U2 QWERTZ Notizgerät, 3. Woodscan Produkterkennung mit Milestone 312 ACE, 4. Fame, Farberkennung für Milestone. Tel.: 05138 5423000
(priv) Tandem „Two Moon“ von Pedalpower zu verkaufen: Robuster Aluminiumrahmen, mit gefedertem Hinterrad, Marzocchi Federgabel vorn mit 100 mm Federweg, Reifengröße 26 Zoll, Hydraulische Scheibenbremsen mit Stahlflexleitung (vorn: Quad QHD-4 203-mm-Scheibe, hinten Magura Julie 203 mm). Schaltung Rohloff Speedhub 500, 14 Gang Nabenschaltung vom Hersteller generalüberholt, Diebstahlschutz wichtiger Komponenten mit Pitlock, Neupreis 6.500 €, für 2.000 € abzugeben. Tel.: 05138 5423000
(priv.) Analoge Schachuhren der Blindenschachgruppe (Firma Jerger, Holzgehäuse, ohne Uhrenglas - Ziffernblatt und Zeiger tastbar) abzugeben. Kontakt: info@dvbs-online.de
(gew.) NEU: Online-Seminare zur iPhone- und PC-Nutzung. In unseren neuen Online-Seminaren bieten wir kompaktes Wissen für sehbehinderte und blinde Smartphone- und PC-Nutzer. In kleinen Gruppen machen wir Sie fit für den Einsatz von VoiceOver und JAWS mit speziell entwickelten Inhalten für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ein Einblick in unser Kursangebot:
- PC- und Windows11 Grundlagen mit JAWS
- Spezialkurs Outlook mit JAWS
- Spezialkurs Internet mit JAWS
- Spezialkurs Word mit JAWS
- Spezialkurs Excel mit JAWS
- iPhone und VoiceOver
- u.v.m.
Alle Informationen zu unseren Online-Seminaren (Termine, Inhalte, Kosten, Ablauf) finden Sie unter www.beta-hilfen.de/online-seminare oder rufen Sie uns an unter 0361 43068310. Aktuelle Seminartermine finden Sie unter www.beta-hilfen.de/aktuelles/seminartermine.
PS: Am 01.10.2025 feiern wir 30 Jahre Beta Hilfen für Sehgeschädigte GmbH. Mehr dazu unter www.beta-hilfen.de/30-jahre-beta
Grafikanzeigen
Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen e. V. (BSVS)
Landeshilfsmittelzentrum
Kompetenz und Beratung inklusive!
- Text- und Grafikservice
- Erstellung von Hörbüchern
- Mobile, persönliche und telefonische Beratung
- Alltagshilfsmittel- und Low-Vision-Beratung
- Peerberatung – Betroffene beraten Betroffene
- Telefonfachvorträge, Telefonkonferenzen
- Vorstellen von Alltags- und Freizeitangeboten
- Anamnese – aktuelle Hilfsmittelnutzung
- Kontaktaufnahme soziale Dienste, Ämter
- Unterstützung bei Antragstellungen
- Einreichung Verordnungen bei Kostenträgern
- Versand von Alltagshilfsmitteln
Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen e. V. – Landeshilfsmittelzentrum
Louis-Braille-Str. 6
01099 Dresden
Tel.: 0351 80 90 624
E-Mail: lhz@bsv-sachsen.de
Web: www.landeshilfsmittelzentrum.de
Onlineshop: www.lhz-dresden.de
blista
Schnuppern macht Spaß!
Reinschauen in eine Schule mit einem einmaligen Profil, kleinen Klassen, ganzheitlicher Förderung und tollen Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Auch alle Quereinsteiger*innen sind herzlich willkommen!
Schnuppertage jeweils samstags von 10 Uhr bis 15 Uhr: 01.11.2025, 06.12.2025, 17.01.2026, 21.02.2026, 18.04.2026 (www.blista.de/schnuppertage). Hier erwartet dich eine breite Auswahl an Schul- und Berufsabschlüssen: Allgemeines Gymnasium, Berufliches Gymnasium (Wirtschaft), Fachoberschulen für Gesundheit und Sozialwesen (nähere Infos unter:www.blista.de/css).
PROStart für alle, die sich beruflich orientieren möchten: 02. bis 06.06.2025, 02. bis 06.02.2026, 02. bis 06.03.2026, 20. bis 24.04.2026, 04. bis 08.05.2026, 08. bis 12.06.2025. Am blista-Zentrum für berufliche Bildung stehen dir 6 Ausbildungen und Umschulungen zur Wahl. (a href="http:www.blista.de/ausbildungen-und-umschulungen">www.blista.de/ausbildungen-und-umschulungen).
Bei der blista bist du richtig!
Deutsche Blindenstudienanstalt e. V. (blista)
blistaCampus
Am Schlag 2-12
35037 Marburg
schuelerberatung@blista.de Tel.: 06421 606-339
ausbildung@blista.de, Tel.: 06421 606-541
Bundesverband der Rehabilitationslehrer /-lehrerinnen für Blinde und Sehbehinderte e.V.
Bei Fragen immer an Ihrer Seite: Rehalehrer:innen für Orientierung und Mobilität und Lebenspraktische Fähigkeiten.
Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft
Deutscher Hilfsmittelvertrieb gem. GmbH (DHV)
Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte
Der Deutsche Hilfsmittelvertrieb gem. GmbH (DHV) bietet Ihnen Hilfsmittel für hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen aller Altersgruppen. Ob für Haushalt, Beruf oder Hobby – unsere Produkte und Dienstleistungen sollen den Alltag erleichtern und Ihnen ein weitgehend selbstständiges Leben ermöglichen.
Gerne sind wir Ihnen bei der Beantragung geeigneter Hilfsmittel über diverse Kostenträger, wie z.B. gesetzliche Krankenkassen behilflich. Sie können unseren gesamten Hilfsmittelkatalog als Druckvariante und auf Hör-CD erhalten, oder besuchen Sie uns im Internet.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Deutscher Hilfsmittelvertrieb gem. GmbH
Bleekstraße 26
30559 Hannover
Telefon: 0511 95465-0
Fax: 0511 95465-37
E-Mail: info@deutscherhilfsmittelvertrieb.de
Internet: www.deutscherhilfsmittelvertrieb.de
Abbildung: 4 Produktkategorien aus dem Angebot: Smartphones, gefalteter Langstock, Anstecker, Uhr.
Dräger Lienert GmbH & Co. KG
Sehbehinderte und blinde Menschen arbeiten mit DL® Produkten einfach und wettbewerbsfähig.
DL® reduziert die Abhängigkeit von Technik. DL® entwickelt ausschließlich barrierefreie Anwendungen. DL® kümmert sich darum, dass Fachanwendungen generell nur noch barrierefrei entwickelt werden. Vom Standard-Blindenarbeitsplatz bis zu Roboteranbindungen, alles, was einen Behindertenarbeitsplatz ermöglicht, wird umgesetzt. Vom Einzelarbeitsplatz bis zum Infrastrukturprojekt – DL® rollt moderne Technik aus.
Melden Sie sich! Wir schicken Ihnen gerne Informationen auf einem Audioplayser.
Draeger Lienert GmbH & Co. KG
E-Mail: info@dlinfo.de
Tel: +49 (0) 6421 952 400
Internet: www.dlinfo.de
Gemeinschaftsstiftung für Blinde und Sehbehinderte in Studium und Beruf
Nachhaltig wirken: Gemeinsam Gutes tun für blinde und sehbehinderte Menschen!
Werden Sie Teil unserer Stiftergemeinschaft – Wir unterstützen Projekte für blinde und sehbehinderte Menschen
Bauen Sie mit am Fundament für Integration und Teilhabe – Ausbildung, Studium und Beruf sind wichtiger als je zuvor.
Unser Ansprechpartnernetz blinder und sehbehinderter Juristinnen und Juristen berät Sie unverbindlich bei Fragen rund um Zustiftungen und Nachlässe.
Gemeinschaftsstiftung für Blinde und Sehbehinderte in Studium und Beruf
gegründet 1998
Frauenbergstraße 8
35039 Marburg
Tel.: 06421 94888-0
E-Mail: gemeinschaftsstiftung@dvbs-online.de
Internet: https://dvbs-online.de/unterstuetzen
Stiftungskonto: Commerzbank Marburg, IBAN DE29 5334 0024 0393 1110 00
F. H. Papenmeier GmbH & Co.KG
Hotline Service - Unser WIR für Ihren Hilfsmittel NOTFALL.
Kostenfreie Hotline: +49 2304 205 250
Kontakt:
F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2
58239 Schwerte
Telefon: +49 2304 205 0
Fax: +49 2304 205 205
E-Mail: info.reha@papenmeier.de
Web: www.papenmeier-rehatechnik.de
Bildbeschreibung: Unser WIR für Ihren Hilfsmittel NOTFALL: Eine Gruppe von drei RehaTechnik Mitarbeiter - zwei Männer und eine Frau – schauen freundlich in die Kamera.
Pedalpower mobility solutions
Tandem Bikes
Deep, mit oder ohne e-Motor – teilbar!
Butterfly, Falttandem – faltbar!
Double Speed Sprint, Renntandem
Cross Country, Reiseradtandem – teilbar!
Berlin Steel, 26’’ oder 28’‘ – teilbar!
Kolibri, Eltern/Kind Tandem
10% Rabatt für DVBS-Mitglieder und deren Angehörige.
Bildbeschreibung: Fotos der sechs Tandems, „Deep“ (schwarzer Lack) und „Butterfly“ (rot lackiert) auch geteilt bzw. zusammengeklappt. QR-Code.
RTB
Gezielte Steuerung der Signale - Per App sicher unterwegs
- Immer sicher unterwegs
- Ohne Anwohnerkonflikte
- Kostenfreie Smartphone-App
- LOC id kompatibel
- LZA – Detektion – Parken – E-Mobilität
RTB
www.rtb-bl.de
Tel.: +49 5252 9706-0
Bild: Bunte Grafik eines bärtigen Mannes mit dunkler Brille und weißem Langstock, der an einer belebten Straße steht. In der Hand ein Smartphone, das Signale aussendet, im Hintergrund eine Großstadt.
Synphon Elektronische Hilfen für Sehgeschädigte
Einfach SynPhon! Die Firma SynPhon entwickelt einfach zu bedienende elektronische Hilfsmittel, die blinden und seheingeschränkten Menschen das Leben erleichtern:
Der Einkaufs-Fuchs Produkt-Erkenner sagt mit einem Piep und Laserscanner, was es für eine Sache ist.
Die Fledermaus Orientierungshilfe erkundet den Raum mit Ultraschall und Infrarot und zeigt, wo es sicher langgeht.
Einfach mal testen! Haben Sie Fragen? Rufen sie an!
Tel.: 07250 929555
www.synphon.de
Vanda Pharmaceuticals
Non-24. Eine zyklische Schlaf-Wach-Rhythmusstörung bei völlig blinden Menschen
Sind Sie völlig blind? Fühlen Sie sich oft nicht fit und unkonzentriert? Schlafen Sie nachts schlecht und sind tagsüber sehr müde? Die mögliche Ursache: Ihre innere Uhr. Jeder Mensch besitzt eine innere Uhr. Der wichtigste Taktgeber ist das Tageslicht. Es setzt die innere Uhr immer wieder auf exakt 24 Stunden zurück. Völlig blinde Menschen fehlt die Lichtwahrnehmung, deshalb kann es dazu kommen, dass der Körper nicht mehr zwischen Tag und Nacht unterscheiden kann. Diese Menschen leiden an der Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, kurz Non-24.
Wie äußert sich Non-24? Betroffenen fällt es phasenweise sehr schwer, sich tagsüber wachzuhalten und zu konzentrieren. Nachts hingegen signalisiert der Körper oftmals kein Schlafbedürfnis.
Rufen Sie das Team des Non-24 Service an. Die erfahrenen Mitarbeiter finden den richtigen ärztlichen Ansprechpartner in Ihrer Nähe und beantworten Ihre individuellen Fragen. Sie sind rund um die Uhr erreichbar unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 24 321 08 oder per E-Mail non24@patient-plus.com
Werden Sie aktiv: Ein Termin bei einem Arzt ist der nächste Schritt oder informieren Sie sich in unseren Tele-Vorträgen. Die Termine finden Sie unter dem Punkt Informationen auf non-24.de
Dies ist ein Service der Firma Vanda Pharmaceuticals Germany GmbH.
